Orgel: Weida-Land / Obhausen – St. Johannis
Für Anfragen kontaktieren Sie bitte das Orgel-Verzeichnis über das Kontaktformular.

Gebäude oder Kirche
St. JohannisKonfession
EvangelischOrt
Weida-Land / ObhausenPostleitzahl
06268Bundesland / Kanton
Sachsen-AnhaltLand
DeutschlandBildergalerie + Videos
Weida-Land/Obhausen (D-ST) – ev. Kirche St. Johannis – Einzel- und Vollgeläut (Turmaufnahme)
Bildrechte: Datenschutz
Orgelgeschichte
1837 Neubau einer mechanischen Schleifladenorgel mit mittig fest eingebautem Spieltisch durch Moritz Baumgarten (Merseburg) I/14. Baumgarten war u.a. Lehrer Friedrich Wilhelm Rühlmanns, der für Baumgarten auch in Kommission und Vertretung baute (z.B. Eismannsdorf).
1851-52 Umbau der Kirche – dabei Umsetzung der Orgel im unveränderten Zustand (!) auf die Westempore des neuen Kirchenschiffes.
1908 Überholung, Einbau eines Doppelfaltenmagazinbalges anstatt zweier Keilbälge durch Julius Strobel&Söhne/Bad Frankenhausen
1917 Abgabe der originalen Prospektpfeifen aus Zink – diese wurden nicht ersetzt. Otto Apel aus Querfurt übernahm diese Arbeiten.
1934 Anbringung von dunklen Stoff-Vorhängen in den leeren Prospektfeldern.
1939 Stimmung der Orgel
1946 Stimmung der Orgel durch Hildebrandt/Roßleben
1948 Stimmung und Regulierung der Klaviaturen durch Hildebrandt
1957 Überholung durch H. Hildebrandt/Roßleben, dabei Einbau eines elektrischen Gebläses und Umhängung der Traktur. Keine Dispositionsänderung. (Inschriftlich: „Abtragung und zwei Halbe Töne tiefer G. Hildebrandt Roßleben“)
13.7.1964 Wartung der Orgel durch Hildebrandt – Regulierung der Klaviaturen und Reparatur. Eine Stimmung erfolgte laut Inschrift nicht.
17.4. erneute Wartung der Orgel – Behebung eines Heulers
2007 Überholung und Sanierung des Werkes mit Einbau neuer Prospektpfeifen aus Zinn durch Thorsten Zimmermann (Halle/Saale).
2023 Orgel vorhanden und gut spielbar.
Die Baumgarten-Orgel in Obhausen ist eines der wenigen erhaltenen Zeugnisse der Kunst ihres Erbauers – wie wunderbar, dass das Instrument in hervorragendem, fachgerecht-saniertem Zustand erhalten ist! Bemerkenswert sind freilich die Art der Disposition auf nur einem Manual und Pedal mit 14 Registern – dabei ein vollständig bis in die Mixtur durchgeführter Principalchor, welcher ein strahlendes, barock anmutendes Plenum zeigt, welches das Instrument auch für Musik dieser Zeit prädestiniert. Daneben fällt der fast überreich disponierte Flötenchor in der 8′- und 4′-Lage auf, welcher die verschiedensten Färbungen im sanften Bereich gestattet und dabei von erhabener Noblesse und Klarheit gekennzeichnet ist. Durch die zart-schneidende Viola di Gamba ist eine Art Vorstufe zum Principal gegeben. Das Pedal grundiert mit zwei 16′-Stimmen, zweier Stimmen in der Achtfußlage mächtig den Klang und erlaubt dabei ebenfalls Differenzierungen. Die Baumgarten-Orgel erlaubt damit nicht nur die Wiedergabe barocker Musik, sondern durch die reichen Grundstimmen auch die Interpretation frühromantischer Musik. Beachtlich ist dabei die Klangkraft und Lautstärke, welche das Instrument in der doch recht mäßigen Akustik des Raumes entfaltet.
Disposition
Manual C – d“‘Principal 8 Fuß. (d°-a“ Prospekt, Zinn) Waldflöte. 8 Fuß. Flauto traverso. 8 Fuß. (ab a°) Gedackt. 8 Fuß. Viola d: Gamba. 8 Fuß. Octave. 4 Fuß. (D-f#° Prospekt, Zinn) Hohlflöte. 4 Fuß. Quinte. 3 Fuß. Octave. 2 Fuß. Mixtur. 4 Fach. |
Pedal C – d‘Subbaß. 16 Fuß. Violon. 16 Fuß. Principal. Baß. 8 Fuß. Violon. 8 Fuß. |
Spielhilfen
Als Registerzug links: Pedal. Coppel. [I/P]
Als Registerzug rechts: Monitor. [Kalkantenzug, schaltet heute die Orgel ein.]
Gebäude oder Kirchengeschichte
Ca. 11./12. Jahrhundert erster Kirchbau an der Stelle der heutigen Kirche, daneben existierten noch zwei weitere Kirchen im Ort (St.Nicolai und St.Petri). Die Nicolaikirche ist heute eine Ruine – nach den Kirchen wurden auch die Ortsteile benannt.
1120 gehört die Kirche zum Kloster Klosterode.
1818 Beschrieb der Kirche durch Pastor Drechsler als baufällig: Dach undicht bzw. offen, Gottesdienste finden deswegen nicht mehr statt, die Mauern sind einsturzgefährdet.
1819 Vorschlag des Kircheninspektors zum Bau einer gemeinschaftlichen Kirche für alle drei Gemeinden, dazu sollte St. Petri erweitert werden. Der Vorschlag wurde nicht umgesetzt.
1839 Guss einer neuen Glocke.
1845 neue Verhandlungen zum Neubau einer Kirche mit Baurat von Helldorf/Querfurt. Wieder wurde der Vorschlag einer gemeinschaftlichen Kirche eingebracht und abgelehnt.
1845 Kirche baufällig, Abriss bis auf den alten Turm
1847 erneuter Versuch eines gemeinschaftlichen Kirchenneubaus – die Gemeinde Johanni wollte ihre Kirche am alten Platz wieder aufbauen, St. Petri sah aufgrund des guten Zustandes ihrer Kirche keine Grund für einen Neubau und wollte sich nicht beteiligen.
März 1847 Erteilung der Baugenehmigung für die neue Kirche.
1. Advent 1851 Weihe der neuen Kirche – der Turm war vom alten Bauwerk übernommen worden und fiel durch seine falsche Proportion unangenehm auf.
1879 Inschriftlich neue Kirchenfenster als Spende von Familie Lücke
1896 Erhöhung des Kirchturmes durch Spitzhelm und neues Glockengeschoss auf 38,5m.
1896 Einbau einer Uhr. Das Zifferblatt wurde so angebracht, dass nur die Gemeindemitglieder der Johanni-Gemeinde die Uhrzeit ablesen konnten (Nordseite des Kirchturmes).
1909 Umgestaltung des Innenraumes – Einbau eines neuen, neobarocken/klassizistischen Kanzelaltares, Umstellung der Bänke im Innenraum, sodass ein Mittelgang entsteht.
1917 Abgabe zweier Glocken zu Rüstungszwecken.
1930 Restaurierung des Innenraumes und Anbringung einer neuen Farbfassung
1950 Instandsetzung des Innenraumes
1970er Jahre Zerstörung eines Buntglasfensters durch Vandalismus, Diebstahl des Kronenleuchters.
Um 1989 ist die Kirche in einem schlechten Zustand, da notwendige Erhaltungsmaßnahmen immer nur notdürftig durchgeführt werden konnten.
2002 Sturmschaden am Turm; die Wetterfahne wird herunter gerissen und muss neu angefertigt und aufgesetzt werden.
2003 umfassende Restaurierung des gesamten Baukörpers, Einbau eines neuen Buntglasfensters.
2009 Guss zweier neuer Glocken bei Lauchhammer als Ergänzung zu einer Schilling-Glocke von 1912 – Tonfolge heute a‘- cis“- e“.
Die Kirche zeigt sich heute als einschiffiger, schlichter Kirchsaal mit halbrunder Apsis im Osten. Auf der Westseite steht der auf quadratischem Grundriss angelegte Turm mit seiner hohen Spitze. Neoromanische Bogenfenster lassen viel Licht in das Innere fallen. Der Innenraum zeigt sich durch seine weiße Farbgebung durchweg hell und freundlich – einzelne goldene Verzierungen (z.B. am Orgelprospekt oder der Kanzel) setzen Akzente. Der Raum wird von einer Holztonne überwölbt und von einer u-förmigen, eingeschossigen Empore umrahmt, deren Kassettenfelder biblische Symbole und Sprüche tragen – die Empore wird von korinthischen Säulen getragen. Dezent gefärbtes, reiches und fein florales Malwerk ist in den Fensternischen, dem Tonnengewölbe und am Apsisbogen vorhanden. Der Kanzelaltar ist äußerst schlicht gehalten, lediglich die Wangen sind aus reichem Akanthusschnitzwerk gefertigt. Möglicherweise wurde auch der Altar mit seiner marmorierten Farbfassung aus der alten Kirche übernommen – ebenso das gotische Taufbecken aus Sandstein.
Anfahrt
Quellenangaben
Orgelbeitrag erstellt von: Johannes Richter
Datein Bilder Kirche und Orgel: Johannes Richter
Orgelgeschichte: Johannes Richter mit Informationen von H. Rotermund
Kirchengeschichte: Wikipedia, ergänzt durch Informationen von H. Rotermund
Video – Weida-Land/Obhausen (D-ST) – ev. Kirche St. Johannis – Einzel- und Vollgeläut (Turmaufnahme) von Johannes Richter Kanal JRorgel


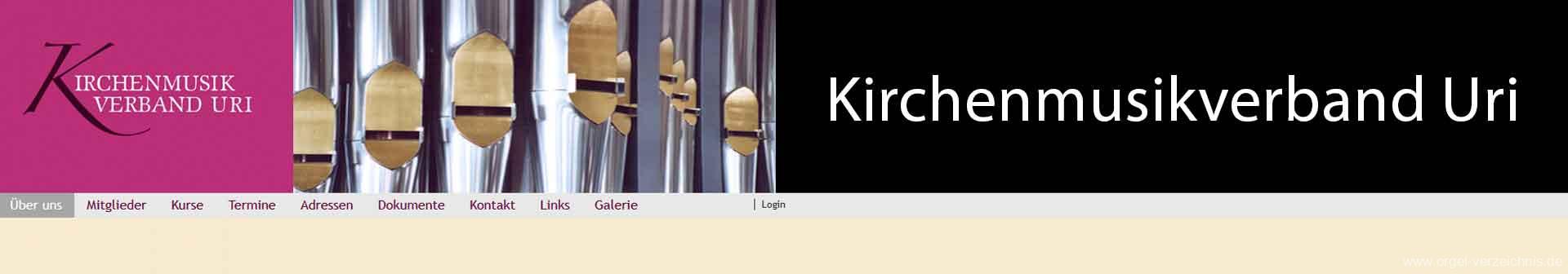

 Deutschland
Deutschland Schweiz
Schweiz Österreich
Österreich Andere
Andere