Orgel: Weida-Land / Barnstädt-Göhritz – St. Kilian
Für Anfragen kontaktieren Sie bitte das Orgel-Verzeichnis über das Kontaktformular.


HELP
Die wertvolle Orgel, eines der wenigen Zeugnisse der Orgelbaukunst von Krug/Merseburg und Schönburg/Schafstädt ist seit Jahrzehnten unspielbar. Das edle Werk bedarf einer dringenden Erhaltung, Sicherung und Sanierung. Leider fehlen der Gemeinde hierzu die finanziellen Mittel.
Gebäude oder Kirche
St. KilianKonfession
EvangelischOrt
Weida-Land / Barnstädt-GöhritzPostleitzahl
06268Bundesland / Kanton
Sachsen-AnhaltLand
DeutschlandBildergalerie + Videos
Weida-Land/Barnstädt-Göhritz (D-ST) – St. Kilian – Einzel- und Vollgeläut (Turmaufnahme) auf Youtube, Kanal JRorgel
Bildrechte: Datenschutz
Orgelgeschichte
1785 Neubau einer Orgel durch Johann Gottfried Krug mit einem Manual und Pedal unbekannter Größe hinter dem heute vorhandenen Prospekt.
Vermutlich geht das Hauptwerk in seiner etwas merkwürdig anmutenden Disposition auf Krug zurück, ebenso wie die Tonumfänge der Manuale.
1832 Erweiterung der Orgel durch Gottlieb Schönburg aus Schafstädt um das Oberwerk auf 19 Register. Im Zuge dessen Fertigung neuer Registerschilder und eines neuen, mit dem großen Cis versehenen Pedals – die Koppel I/P greift an dieser Stelle in das cis° ein. Ebenfalls erfolgte eine Erweiterung des Prospektes um die unteren Felder – das ehemalige Werksgehäuse wurde nach oben gesetzt. Es handelt sich um eine mechanische Schleifladenorgel mit mittig fest eingebautem Spieltisch.
1856 Reparatur durch Wilhelm Hellermann (Querfurt).
1867 Abtragung der Orgel durch Wilhelm Hellermann/Querfurt im Zuge der Sanierung des Kirchenschiffes.
1868 Aufstellung und erneute Wartung durch Hellermann – Reinigung und Stimmung der Posaune 16′. Dieses Register verschwand später auf ungeklärten Wegen.
1931 Kostenvoranschlag von Wilhelm Rühlmann/Zörbig für einen Orgelneubau mit II/16+2 auf pneumatischen Kegelladen – der Vorschlag kam nicht zur Ausführung.
1931 Einbau einer elektrischen Windmaschine durch Wilhelm Rühlmann aus Zörbig.
1952 letzte Reparatur der Orgel durch Gustav Hildebrandt aus Roßleben – danach Verschlechterung des Zustandes und Diebstahl von Pfeifen.
1965 wird über einen schlechten Zustand des Werkes berichtet. Das Instrument wird als „wertvoll und recht gut klingend“ beschrieben.
2023 die Orgel ist vorhanden, aber nicht spielbar. Durch Staub und Dreck ist das Instrument gefährdet, die Kirche wird kaum genutzt. Einige Pfeifen fehlen.
Die Krug-Schönburg-Orgel in der Göhritzer Kirche blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück, die sie leider mit ihrer Stimme seit geraumer Zeit nicht verkünden und erzählen kann, sodass der Autor zum klanglichen Charakter des Werkes nicht viel Worte wiedergeben kann, außer, dass einige Heuler beim Einschalten des Windmotors sich deutlich vernehmen, aber keinen Aufschluss über den Klang der Orgel geben lassen. Prachtvoll ist der reich mit Schnitzwerk versehene Prospekt in seiner Farbfassung aus den 30er Jahren. Das Innere der Orgel zeigt sich dagegen weniger prachtvoll: fehlende und beschädigte Pfeifen, starke Verschmutzung und Holzwurmbefall erzählen eine traurige Geschichte jahrzehntelanger Nichtpflege. Ein wenig kurios mutet die Disposition des Hauptwerkes an, vielleicht noch auf Krug zurückgehend, dessen Werk auf 4′-Principalbasis stand. Nichtsdestotrotz ist die 8′-Palette ausdifferenziert, noch weiter verbreitert durch das zugefügte Oberwerk von Schönburg, welcher dem Werk auch einen Streicher und einen tragenden Principal spendierte. Die Registerschilder des Oberwerkes wurden mit einem kleinen Eisernen Kreuz bzw. einem +-Zeichen markiert, desgl. das Sperrventil des Oberwerks – ein weiteres Indiz für die Zufügung. Bemerkenswert ist die Differenz zwischen Manual- und Pedalumfang – im Pedal ist das große Cis vorhanden, im Manual aber nicht – eine Reminszenz an vergangene Zeiten… Es wäre wünschenswert, dass dieses bedeutende Instrument mit seinen 19 Registern auf mechanischen Schleifladen wieder in alter Pracht erstehen und seine Stimme zum Lobe Gottes erheben darf.
Disposition
I – Hauptwerk C, D-c“‘Bordun 16 Fuß. Hohlfl 8 Fuß. Flöte tr. 8 Fuß. Quintet (sic!) 8 Fuß. Princip. 4 Fuß. Quinte 3 Fuß. Octave 2 Fuß. Mixtur 3fach Cornett 3fach (ab c‘) |
II – Oberwerk C, D-c“‘Prinzip. 8 Fuß. Gedackt 8 Fuß. Gambe 8 Fuß. Gedackt 4 Fuß. Prinzip. 2 Fuß. Quinte 1 1/2 Fuß.
|
Pedal C-c‘Sub.Baß 16 Fuß. Viol.Bß. 16 Fuß. Pr.Baß 8 Fuß. Posaune 16 Fuß. (heute Violoncello 8′)
|
Die Registerschilder des Oberwerkes sind oben mittig mit einem kleinen eisernen Kreuz versehen, desgleichen das Sperrventil des Oberwerkes.
Spielhilfen
Als Registerzug auf der linken Seite oben: Pedal,,Ventil [Sperrventil Pedal], Ober ,, Ventil [Sperrventil II], Haupt Ventil [Sperrventil I]
Als Registerzug auf der rechten Seite oben: Calcant Stops [was die kleine Unterschrift „Stops“ zu heißen hat, kann nicht ermittelt werden]
Als Registerzug auf der rechten Seite unten: Pedal ,, Coppel [I/P]
An den Klaviaturbacken des zweiten Manuales zu betätigen: Schiebekoppel II/I
Die Doppelkommata entsprechen denen auf den Registerschildern, welche dort als Zeilenumbruch zu finden sind.
Gebäude oder Kirchengeschichte
9. / 10. Jahrhundert erster Kirchbau in Göhritz, dem Hl.Kilian geweiht – das Patrozinium des 688 ermordeten Heiligen weist auf die Zeit der Mission in Thüringen hin. Die Kirche des damals eigenständigen Dorfes war eine Filiale von Barnstädt.
13. Jahrhundert Anbau eines Turmes.
1563 Fertigung des achteckigen Taufsteines.
1775 Planungen zum Bau einer neuen Kirche.
1780 – 1782 Bau des neuen Kirchenschiffes aus Eigenmitteln der Gemeinde in der heutigen Gestalt, dabei auch Aufsatz einer oktogonalen Glockenstube auf den Turm, bekrönt von welscher Haube.
1787 Neuguß dreier Glocken durch die Gießer Gebr. Ulrich (Laucha) mit den Durchmessern 101cm, 79cm und 60cm – die große Glocke wurde mehrmals umgegossen.
1867 Verputzung des Kirchenschiffs in weißer Farbe durch Malermeister Lisker/Querfurt
1917 Abgabe der zwei großen Glocken für Rüstungszwecke.
1922 Guss zweier neuer Eisenglocken bei Schilling & Lattermann.
1930er Jahre Restaurierung des Innenraums, dabei Neufassung der Farbe in der heutigen Gestalt – deutlich schlichter als der Ursprungszustand.
1967 Sanierung und Restaurierung des Inneren.
1989 erste Sanierungsarbeiten am Turm.
1997 Neudeckung des Daches vom Kirchenschiff.
2000 Erneuerung des Dachstuhles und der Turmverschalung.
Heute wird die Kirche selten genutzt und fristet eher unbekannt ihr Dasein.
Die große Dorfkirche in Göhritz ist für die Dimensionen des Ortes fast absurd groß – über 250 Sitzplätze bietet sie. Zum Zeitpunkt der Erbauung zählte das Dorf Göhritz nur 250 Einwohner, scheinbar war deren Optimismus in den festen Glauben ihrer Ortsgemeinde groß und immerhin wurde die Kirche auch komplett aus Eigenmitteln finanziert und reich ausgestattet.
Das Gotteshaus zeigt sich als großer einschiffiger Saalbau mit Westquerturm, dessen quadratisches Untergeschoss aus früherer Zeit in eine um 1780 aufgesetzte oktogonale Glockenstube samt welscher bzw. geschweifter Haube samt Laterne mündet. Das Kirchenschiff selbst zeigt sich rechteckig, mit geradem Chorabschluss. Der hohe Raum wird von 4 hohen Fenstergruppen erleuchtet, die in je ein kleines unteres Rechteckfenster und ein großes oberes Fenster unterteilt sind, welche jeweils rötliche Sandsteinlaibungen besitzen. Das Innere ist in der heutigen Farbfassung sehr hell und weit – es dominiert die Farbe weiß. Der weite Raum wird von einer mit edler Stuckatur verzierten Flachdecke überwölbt und von doppelgeschossig ausgeführten, u-förmig verlaufenden Emporen gerahmt, welche Rechteckfelder besitzen und ebenfalls mit dezenter Stuckatur verziert sind. Das untere Geschoss ruht auf dorischen Säulen, das Obere auf Korinthischen. Dominierend ist der große Kanzelaltar, dessen Korb von zwei marmoriert bemalten korinthischen Säulen flankiert wird. Zu beiden Seiten sind seitliche Verschläge mit Türen und verglasten Fenstern angebracht, auf den Seitenteilen befinden sich dekorative Vasen. Links und rechts des Korbes stehen zwei Statuen von Frauen mit Ährenzweigen – auf das Abendmahl hinweisend. Der Schalldeckel ist mit rot-goldenem Vorhangschnitzwerk versehen und trägt eine fein gearbeitete Bügelkrone. Bekrönt wird der Altar auf dem Baldachin durch Christus in der Mitte, umrahmt von Paulus und Petrus und zwei sitzenden Engeln. Das hölzerne Taufbecken wird von drei Putten getragen, der Lesepultaufsatz zeigt einen Pelikan. Korrespondierend zum Knorpelschnitzwerk des Altars ist auch der Orgelprospekt mit solchem versehen, dezente goldene Akzente gliedern den durch die weiße Farbgebung auffällig schlicht und erhaben wirkenden Raum. Edel und schlicht, von weiter Größe und großer Erhabenheit ist dieser Raum, dem eine weitere und vor allem intensivere Nutzung sehr zu wünschen wäre.
Anfahrt
Quellenangaben
Orgelbeitrag erstellt von: Johannes Richter
Dateien Bilder Kirche und Orgel: Johannes Richter
Orgelgeschichte: Johannes Richter – eigene Sichtungen, ergänzt durch Informationen von H. Rotermund
Kirchengeschichte: Johannes Richter, basierend auf Informationen von H. Rotermund sowie
H. Rotermund: Die Göhritzer St. Kilian-Kirche in: Stadt-und Landbote Weida-Land, Jahrgang 04, Dezember 2008, S.6/7


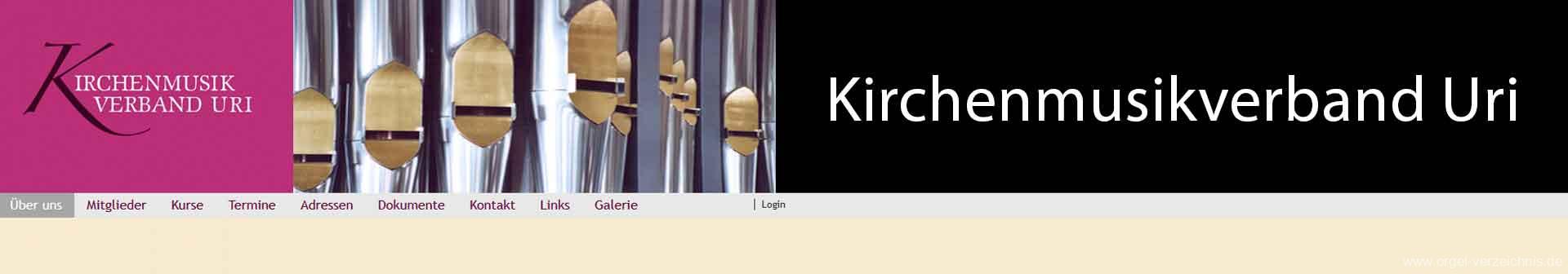

 Deutschland
Deutschland Schweiz
Schweiz Österreich
Österreich Andere
Andere