Orgel: Querfurt – Burgkirche (St. Maria, Peter und Paul)
Für Anfragen kontaktieren Sie bitte das Orgel-Verzeichnis über das Kontaktformular.

Gebäude oder Kirche
Burgkirche St. Maria, Peter und PaulKonfession
EvangelischOrt
QuerfurtPostleitzahl
06268Bundesland / Kanton
Sachsen-AnhaltLand
DeutschlandBildergalerie + Videos
Orgelgeschichte
Um 1712 Neubau einer ersten Orgel im Zuge der Erweiterung und Neugestaltung der Kirche. Ihre Existenz ist bis dato nicht bezeugt, der Autor stellt sich aber die Frage, wieso ein derart prachtvoll ausgestattetes Gotteshaus keine Orgel hätte erhalten sollen. Dieses Werk stand nicht auf der Westempore, diese diente als Fürstenloge. Vermutlich stand das Werk über der Kanzel.
1887 Neubau einer vorderspieligen mechanischen Schleifladenorgel II/14 durch Wilhelm Rühlmann sen./Zörbig (Op.86) mit neoromanischem Gehäuse auf der Westempore.
1917 Abgabe der Prospektpfeifen zu Rüstungszwecken – die Prospektpfeifen wurden nicht ersetzt.
1972 Ende der Nutzung der Orgel zusammen mit der Kirche, das Instrument verfällt.
1992 die Rühlmann-Orgel ist noch als Ruine vorhanden, aber nicht mehr spielbar. Ein Neubau wird erwogen.
1993/94 Neubau einer vorderspieligen mechanischen Schleifladenorgel II/24 durch Alexander Schuke Orgelbau Potsdam (Op.594) im nördlichen Querhaus. Das Hauptwerk steht vorne, 35 Prospektpfeifen in 5 Feldern á 7 Pfeifen bilden die Schaufront. Schwellwerk und Pedal stehen dahinter.
22. Mai 1994 (Pfingsten) – Einweihung der neuen Orgel.
Um 2012 Reinigung der Orgel durch Orgelbau René Paul/Niederröblingen.
2022 Einhausung der Orgel infolge Restaurierungsarbeiten in der Burgkirche.
Dezember 2022 Nachintonation und Reinigung durch Orgelbau René Paul.
Disposition
Disposition Schuke-Orgel 1994 (Op.594)
Manual I – Hauptwerk C – g“‘Principal 8′ (ab D Prospekt, Zinn) Koppelflöte 8′ Gambe 8′ [ab C offen] Oktave 4′ Nachthorn 4′ Hohlquinte 2 2/3′ Gemshorn 2′ Mixtur 4′ [sic, 1 1/3′ 4fach, rep. immer auf c] Trompete 8′
|
Manual II – Schwellwerk C – g“‘Gedackt 8′ Salicional 8′ [C-F gedeckt, ab F# offen] Principal 4′ Rohrflöte 4′ Nassat 2 2/3′ Waldflöte 2′ Terz 1 3/5′ Sifflöte 1′ [ab d#“‘ 1 1/3′] Cymbel 3′ [sic, 1′ 3fach, rep. c°, c‘, f#‘, c“, f#“, c“‘] Schalmei 8′
|
Pedal C – f‘Subbaß 16′ Oktavbaß 8′ Baßflöte 8′ Oktave 4′ Fagott 16′ [Becher und Stiefel Holz]
|
Disposition Rühlmann-Orgel 1887 (Op.86)
Manual I – Hauptwerk C – f“‘Bordun 16′ Principal 8′ Hohlflöte 8′ Viola di Gamba 8′ Octave 4′ Gedackt 4′ Mixtur 3fach
|
Manual II – Oberwerk C – f“‘Geigenprincipal 8′ Gedackt 8′ Salicional 8′ Flauto amab. 4′
|
Pedal C – d‘Subbass 16′ Violon 16′ Principalbass 8′
|
Spielhilfen
Schuke-Orgel Op.594 (seit 1994)
Als Registerzüge links unten, von links (wechselwirkend mit Tritten): II/I, II/P, I/P
Als Registerzüge links mittig unten: Tremulant [HW], Tremulant [SW]
Über dem Pedal links als Fußtritte, von links: II/I, II/P, I/P
Mittig über dem Pedal: Balanciertritt für Jalousieschweller II
Rühlmann-Orgel 1887-1992
Manual-Coppel, Pedal-Coppel [I/P], Calcant (vermutl. als Registerzüge)
Gebäude oder Kirchengeschichte
Um 890 Erwähnung der Burg Querfurt im Zehntverzeichnis des Klosters Hersfeld, in dieser Zeit Stiftung einer ersten Burgkapelle.
1004 Stiftung einer Burgkapelle als repräsentativer Neubau. Sie blieb unvollendet. Zeitgleich Gründung eines Chorherrenstiftes durch den Hl. Brun von Querfurt.
12. Jahrhundert Anbau diverser Kapellen – dies wurde bei Grabungen belegt. Die Kirche hatte dadurch eine eher unförmige Gestalt.
1150 Beginn eines romanischen, repräsentativen Neubaus (andere Quellen nennen 1162) mit Vierungsturm.
1175 Vollendung des Kirchenneubaus.
Ab 1323 Nutzung der Kirche als Grabstätte für die Grafen von Querfurt.
Um 1380 Errichtung der Grabkapelle samt Tumba für Graf Gebhard XIV.
1698 Beginn einer umfassenden Renovierung unter Herzog Johann Georg, dabei entstand der Unterbau des heutigen Altars.
1704 kommen die Bauarbeiten zum Erliegen.
1712 ist die Kirche nach wie vor unvollendet. Herzog Christian fasst den Plan, das Projekt bis Advent 1712 zu vollenden. Dieses Vorhaben scheitert wegen Frostwetters und einem Kirchenneubau in Sangerhausen.
Um 1715 Fertigung der Altarfiguren.
1716 Umbau und Erweiterung der Kirche unter Herzog Christian, dabei Erwähnung des Patroziniums St. Maria, Peter und Paul – im Zuge des Umbaus wurde das Kirchenschiff zum Vierungsturm geöffnet. Der Turm wurde prachtvoll ausgemalt. Ein Verbindungsbau vom Fürstenhaus zur Loge im Westen wurde geschaffen.
1716 Guss einer Glocke durch (inschriftlich) Iohann Böhem [sic]/Naumburg für den damaligen Glockenturm.
31.10.1716 Wiedereinweihung der umgebauten Kirche – Umwidmung als „Hofkirche zum Hl. Kreuz Christi“.
1846-50 Restaurierung der Kirche, teilweise Entfernung der barocken Ausstattung.
1902-06 Restaurierung der Kirche – Veränderung der Ausmalung, Entfernung weiterer Teile der barocken Ausstattung.
1972 endet die Nutzung der Kirche.
1992 Wiedereröffnung der Kirche nach der Wende.
2020 Bauarbeiten im Burghof, die Kirche ist zeitweilig nicht zugänglich.
2022 Restaurierungsarbeiten im Innenraum der Kirche.
Anfahrt
Quellenangaben
Orgelbeitrag erstellt von: Johannes Richter
Dateien Bilder Kirche und Orgel: Johannes Richter
Orgelgeschichte: Johannes Richter, Sichtung vor Ort und Spiel, ergänzt durch Informationen von H. Rotermund und Informationen aus: H.J.Falkenberg – Zwischen Romantik und Orgelbewegung: Die Rühlmanns. Ein Beitrag zur Geschichte mitteldeutscher Orgelbaukunst 1842-1940. Orgelbaufachverlag Rensch, ISBN: 978-3-921848-19-7
Kirchengeschichte: Johannes Richter Sichtung vor Ort mit Informationen von Schautafeln vor Ort, ergänzt durch Informationen eines Beitrages auf der Webseite Rosarium Sangerhausen, abgerufen am 10. Dezember 2022 sowie eines Beitrages im Web-Archiv von Sachsen-Anhalt Wiki, abgerufen am 10. Dezember 2022
Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Kantorin E. Reiter


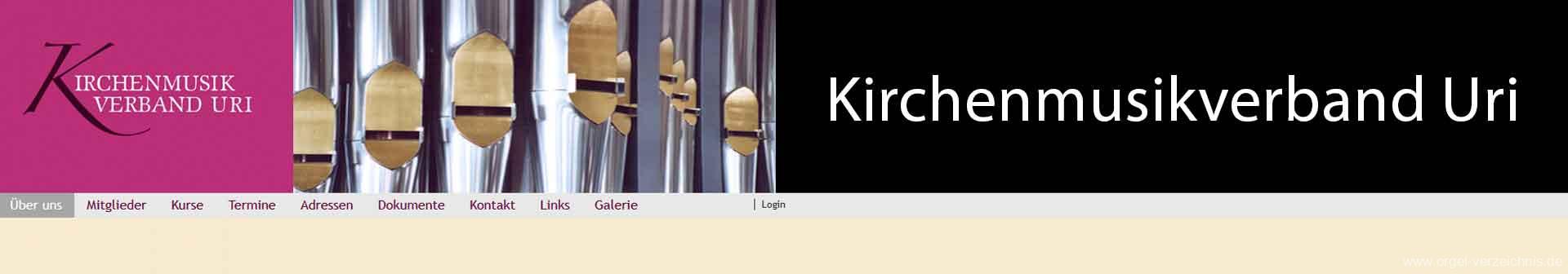

 Deutschland
Deutschland Schweiz
Schweiz Österreich
Österreich Andere
Andere