Orgel: Landsberg (Saalekreis) / Niemberg – St. Ursula
Für Anfragen kontaktieren Sie bitte das Orgel-Verzeichnis über das Kontaktformular.

Gebäude oder Kirche
St. UrsulaKonfession
EvangelischOrt
Landsberg (Saalekreis) / NiembergPostleitzahl
06188Bundesland / Kanton
Sachsen-AnhaltLand
DeutschlandBildergalerie + Videos
Johannes Richter – Improvisation über „Geh‘ aus, mein Herz, und suche Freud'“(EG503)
Johannes Richter – Landsberg/Niemberg (D-ST) – ev. Kirche St. Ursula – Einzel- und Vollgeläut – Einzel- und Vollgeläut (Turmaufnahme)
Bildrechte: Datenschutz
Orgelgeschichte
1685 Aufstellung einer kleinen Orgel I/11 und Pedal durch Heinrich Tiensch/Löbejün
1744/45 Revision der Orgel durch Johann Christoph Zuberbier
ab 1756 Christoph Contius ist mehrmals (1758-61) an der Orgel tätig.
1780 Revision durch Johann Friedrich Leberecht Zuberbier
1828 Erneuerung und Umdisponierung durch Johann Gottlieb Kurtze/Halle für 50 Reichstaler, dabei Einbau einer Traversflöte 8′
1865 Verkauf der alten Orgel zum Abbruch an Wäldner
Heutige Orgel
1864 – 1865 Neubau der Orgel für die ebenfalls neu erbaute Kirche durch August Ferdinand Wäldner (Halle) mit zwei Manualen als vorderspielige Schleifladenorgel mit 16 Registern.
1917 Abgabe der Prospektpfeifen und Ersatz durch Zinkpfeifen durch die Firma Rühlmann (Zörbig).
Um 1937 Pflege durch Orgelbauer Rühlmann, dabei Umdisponierung des Oberwerkes und Ergänzung von Registerschildern in originalgetreuer Fraktur, welche zu späterer Zeit untypisch waren.
1978 Stimmung und Überholung des Werkes durch Arno Voigt (Bad Liebenwerda), dabei Austausch des Violon 16′ gegen Choralbass 4′.
1999 Überholung der Orgel durch Thomas Schildt (Halle).
In diesem veränderten Zustand ist das Werk bis heute einigermaßen gut spielbar erhalten.
Die Wäldner-Orgel in Niemberg zeigt höchst interessante Verwandtschaft mit dem Prospekt der Domorgel in Halle (1851). Ähnlich wie dieser, ist der charakteristische Prospekt in Niemberg fünfgliedrig. Ein überhöht flaches Mittelfeld wird von zwei kleinen Flachfeldern eingeschlossen und von zwei runden Türmen außen am Prospekt gerahmt, wobei diese hier in Niemberg um die Ecken des Gehäuses herum gezogen sind und nicht wie in Halle flach in die Seitenwand übergehen. Möglicherweise erhielt Wäldner diese Anregungen, die sicher von Schinkel oder dem Architekten der Kirche Stüler stammten, als er um 1860 in Berlin tätig war.
Im Inneren zeigt das Werk eine behutsame Öffnung Wäldners für die Neuerungen seiner Zeit: Das Hauptwerk besitzt eine durch Buchholz inspirierte wellenbrettlose Traktur, wogegen das als Hinterwerk angelegte Oberwerk und das Pedal noch konventionelle Wellenbretter besitzen. Die Traktur des Hauptwerkes ist dabei von durchaus angenehmer und leichter Spielbarkeit, die des Oberwerkes ist deutlich schwergängiger. Alle Werke sind Wäldner-typisch hintereinander angeordnet (Pedal hinten) und sind chromatisch aufgestellt. Der Klangfluss ist trotz der Turmkammer, die das Werk verbirgt, durchsichtig und dem Raum angemessen.
Leider erfuhr das Werk einige wenig schmeichelhafte Anpassungen, die seinen Klangcharakter, welcher einstmals eine große Einheit war, entstellen. Das Hauptwerk zeigt die klassische Dispositionsweise einer Wäldner-Orgel: basierend auf einem fülligen, dunkel-weichen Bordun 16′ entfaltet sich eine sanglich, kraftvoll-strahlende und sehr tragfähige Principalpyramide. Hier ist diese noch eingefärbt durch eine näselnd weite Quinte 2 2/3′, nach oben hin bekrönt durch eine später leider etwas angespitzte Mixtur 3fach, die dem Werk eine golden glitzernde Krone verleiht. Daneben finden sich eine weite, für Wäldner seltene Doppelflöte 8′, die durch einen vollmundig-weichen, fülligen und cantabel mischfähigen Klang besticht, sowie eine scharf lyrisch-hervortretende Viola di Gamba. Eine weitere für Wäldners größere Instrumente typische Ausdifferenzierung stellt das Gedackt 4′ mit seinem hell mischfähigen, beweglich-leichten Klang dar. Das Hauptwerk zeigt sich bis auf die Veränderung der Mixtur im originalen, dunkel-gravitätischen, starken und sehr mischfähigen Klanggewand. Die einstmals das Hauptwerk abrundende und weiter differenzierende, weich lyrisch-geheimnisvolle Klanggestalt des Oberwerkes wurde leider empfindlich entstellt. Das hohle, etwas düster-dumpfe, Gedackt 8′ trägt zwar sehr gut. Der später eingefügte, weich singende, schmale und recht helle Geigenprincipal 4′ bildet eine willkommene Abstufung der Octave 4′ des Hauptwerk und verleiht dem Ganzen etwas Gewicht. Den Klangcharakter entstellen allerdings die sehr spitze Waldflöte 2′ und die aufgrund ihrer hohen Tonlage so gar nicht passende, sehr scharf glitzernd-spitze Zimbel, die sich in keiner Weise einfügt, während die Waldflöte dies bis zu einem gewissen Grade noch vermag. Hier wurde die einstmalige Funktion des Werkes konterkariert, missverstanden und „aufgewertet“ und somit der Charakter der gesamten Orgel zerrissen und entstellt, die Mischfähigkeit gestört, abgerundete milde Weichheit genommen und durch Spitze und Schärfe „ersetzt“, was auch im Gegensatz zum abgerundet schwungvollen Aussehen des Prospektes steht.
Ebenfalls empfindlich beschnitten wurde das Pedal, dessen starker (für die Wäldnersche Klangkonzeption unentbehrlicher und heute stark fehlender) Violon 16′ einem damals für unabdingbar gehaltenen, eher sinnlos leisen, indifferenten und nicht überzeugend gestalteten Choralbass 4′ weichen musste. So bildet der dunkle, murmelnde Subbass zusammen mit dem Principalbass, welcher einen recht starken Strich besitzt, heute das alleinige Fundament der Orgel. Der Violon fehlt unabdingbar für eine ausreichende Grundierung vieler Klänge der Orgel.
So zeigt sich der Gesamtklang heute gespalten, teils gravitätisch-edel, teils spitz und schrill, getragen von recht wenig Fundament. Eine Rekonstruktion auf die Disposition Wäldners wäre dem kostbaren und viel genutzten Instrument sehr zu wünschen!
Disposition
Disposition Wäldner-Orgel Stand 2021
Manual I – Hauptwerk C – f“‘Bordun 16 Fuß. Principal 8 Fuß. Doppelflöte 8 Fuß. Viola di Gamba 8 Fuß. Octave 4 Fuß. Gedackt. 4 Fuß. Quinte 2 2/3 Fuß. Octave 2 Fuß. Mixtur 3 fach. |
Manual II – Oberwerk C – f“‘Gedackt 8 Fuß. Geigend prinzipal 4 Fuß Blockflöte 2 Fuß Zimbel 3fach 2/3 Fuß
|
Pedal C – d‘Subbaß 16 Fuß. Principal baß 8 Fuß. Choralbaß 4’* |
*Registerschild mit bedrucktem Papier, nicht aus Porzellan, Schrift nicht Fraktur
Disposition 1937
Manual I – Hauptwerk C – f“‘Bordun 16 Fuß. Principal 8 Fuß. Doppelflöte 8 Fuß. Viola di Gamba 8 Fuß. Octave 4 Fuß. Gedackt 4 Fuß. Quinte 2 2/3 Fuß. Octave 2 Fuß. Mixtur 3 fach. |
Manual II – Oberwerk C – f“‘Gedackt 8 Fuß. Flauto trav. 8 Fuß. Geigend principal 4 Fuß. Flauto amabile 4 Fuß.
|
Pedal C – d‘Subbaß 16 Fuß. Violon 16 Fuß. Principal baß 8 Fuß. |
Disposition 1865
Manual I – Hauptwerk C – f“‘Bordun 16 Fuß. Principal 8 Fuß. Doppelflöte 8 Fuß. Viola di Gamba 8 Fuß. Octave 4 Fuß. Gedackt 4 Fuß. Quinte 2 2/3 Fuß. Octave 2 Fuß. Mixtur 3 fach. |
Manual II – Oberwerk C – f“‘Gedackt 8 Fuß. Flauto trav. 8 Fuß. Salicional 8 Fuß. Flauto amabile 4 Fuß.
|
Pedal C – d‘Subbaß 16 Fuß. Violon 16 Fuß. Principal baß 8 Fuß. |
Disposition der Orgel von Heinrich Tiensch (1685)
ManualGedackt 8′ Quintadena 8′ Prinzipal 4′ Gedackt 4′ Quinte 2 2/3′ Octave 2′ Terz 1 3/5′ Superoctave 1′ Mixtur |
PedalSubbaß 16′ Octavbaß 8′ |
Spielhilfen
Als Registerzüge rechts unten: Manual Coppel [II/I], Pedal Coppel [I/P]
Gebäude oder Kirchengeschichte
Um 1100 Erwähnung einer Kirche im Ort, vermutlich ein kleiner Bruchsteinbau.
Anfang 14. Jahrhundert – Guss der heutigen großen Glocke
Mitte 14. Jahrhundert – Guss der kleinen Glocke
Um 1550 Schaffung des gotischen Schnitzaltars für die alte Kirche.
1860 Baufälligkeit am alten Gebäude
1862 – 1864 Neubau der Kirche aus Porphyrbruchstein nach Plänen von Friedrich August Stüler, der auch die (nahezu baugleiche) Kirche in Petersberg/Wallwitz plante.
1917 Abgabe einer der drei Glocken zu Rüstungszwecken.
1930er Jahre Erneuerung der Farbfassung des Innenraums zur heutigen Gestalt.
1940 Abgabe der großen Glocke auf den Glockenfriedhof, nach dem Krieg kehrte sie zurück.
1965 Umhängen der Glocken an gekröpfte Stahljoche mit Gloria-Läutemaschinen.
Ende 1990er Jahre Sanierung der Kirche.
Die St. Ursula-Kirche in Niemberg liegt versteckt und abseits der Hauptstraßen des Ortes. Ihre hohe Spitze mit dem markanten bekrönenden Kreuz ist weithin, sowohl von den Straßen in der Landschaft als auch von der Bahnstrecke Halle-Magdeburg, gut sichtbar. Eingebettet in einen malerischen, dicht von Bäumen umstellten Kirchhof liegt das aus rötlich-dunklem Porphyrstein erbaute Gotteshaus im Zentrum des Ortes. Stüler entwarf einen der Kirche zu Wallwitz nahezu identischen, großen einschiffigen Saalbau mit eingezogenem Turm auf einem rechteckigen Grundriss mit einer fensterlosen, halbrunden Ostapsis im historistischen bzw. neoromanischen Stil. Die Apsis besitzt einen Halbbogenfries, darüber befindet sich eine Maßwerkrosette. Das mächtige, erhabene Bauwerk weist eine Werksteingliederung auf, der Westturm besitzt über dem Glockengeschoss mit halbbogigen Schallarkaden ein Satteldach mit aufgesetztem, weithin sichtbaren Dachreiter mit Spitzhelm und Kreuz. Über ein Westportal im Rundbogenstil mit skulptierten Blattkapitellen betritt der Besucher den durch die hohen Halbbogenfenster hellen und freundlichen, weiten Raum.
Die Wände des Inneren sind weißlich-beige gefärbt und durch angedeutete, an den Seiten mit weinrot abgesetzte Säulen gegliedert, die mit weich vorschwingenden Kapitellen eine Holzbalkendecke in dunkelgrüner Farbfassung in Kassettenbauart tragen. Einzelne Felder sind mit je einem goldenen Stern auf rotem Grund angeordnet. Die Chorwand ist in beige gehalten, der hohe Apsisbogen ist durch in weiß abgesetzte Säulen mit roten Kapitellen und einem umlaufenden Gesims gegliedert – die Apsis selbst besitzt ein Tonnengewölbe. Ein dunkelrotes, schmales Zierband umrahmt den hohen Halbbogen der Apsis. Bemerkenswert ist der hochwertig gotische Schnitzaltar, welcher im Mittelfeld eine Mondsichelmadonna, flankiert von zwei Heiligen, und in den Flügeln in zwei Reihen angeordnet die zwölf Apostel zeigt. In der Predella des reich mit goldenem Schnitzwerk verzierten Retabels ist eine Szene der Anbetung zu sehen. Die Außenseiten sind mit Heiligendarstellungen bemalt und zeigen Anklänge an die Cranach-Schule. Links vom Altar befindet sich die polygonale Kanzel auf einem schlanken Schaft stehend, die neben zierenden Rundbogenfenstern mit einem goldenen Schriftband versehen ist. Zwei verglaste, schlichte Logen stehen sich vor dem Chor gespiegelt gegenüber. Bemerkenswert ist der große Bronzeengel, der eine Kopie einer 1838 geschaffenen Skulptur in Kopenhagen darstellt. Die u-förmig umlaufende Empore ruht auf angedeuteten korinthischen Säulen mit rundem, grün gefasstem Schaft, die durch angedeutete Säulen gegliederten Kassetten- bzw. Gitterfelder sind farblich in rot abgesetzt. Die ganze Farbfassung in rot-dunkelgrün-weiß verleiht dem Innenraum der St. Ursula-Kirche in Niemberg eine ernste, stille, dunkel-besinnliche Atmosphäre und hebt die einzelnen Gegenstände vor den hellen Wänden eindrücklich ab, bekrönt vom Wechselspiel des edlen Prospektes und dem aus der Vorgängerkirche übernommenen Altarretabel. Ein Besuch des edel-schlichten, ganz auf das Wort und die Musik konzentrierten Gotteshauses mit seiner ernst erhabenen Wirkung ist lohnenswert. Das Zusammenspiel des dunkel-kantig-dunklen Äußeren und des schlichten Inneren verstärkt diesen Eindruck zusätzlich.
Anfahrt
Quellenangaben
Orgelbeitrag erstellt von: Johannes Richter
Dateien Bilder Kirche und Orgel: Johannes Richter
Orgelgeschichte: Johannes Richter mit Informationen der Wäldner-Webseite, ergänzt durch Informationen aus: W. Stüven – Orgel und Orgelbau im Halleschen Land vor 1800, Breitkopf&Härtel, Wiesbaden 1964
Kirchengeschichte: Informationen des Internetauftritt der Gemeinde
Historische Disposition in: W. Stüven – Orgel und Orgelbau im Halleschen Land vor 1800, Breitkopf&Härtel, Wiesbaden 1964, S.52
Youtube-Videos von Johannes Richter auf dem Kanal JRorgel


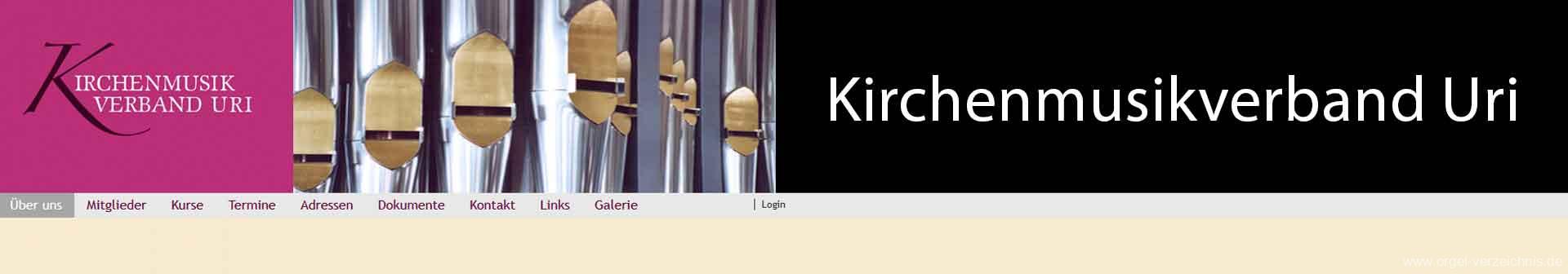

 Deutschland
Deutschland Schweiz
Schweiz Österreich
Österreich Andere
Andere