Orgel: Kabelsketal / Dölbau-Naundorf – St. Petrus, Paulus und Ursula
Für Anfragen kontaktieren Sie bitte das Orgel-Verzeichnis über das Kontaktformular.


HELP
Für die Restaurierung der Wäldner-Orgel in Naundorf werden dringend Spenden benötigt. Helfen auch Sie mit, dass das prachtvolle kleine Werk für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte erhalten bleibt und zum Lobe Gottes und seines Erbauers erklingen darf! Weitere Informationen sowie Daten für mögliche Spenden finden Sie hier.
Gebäude oder Kirche
St. Petrus, Paulus und UrsulaKonfession
EvangelischOrt
Kabelsketal / Dölbau-NaundorfPostleitzahl
06184Bundesland / Kanton
Sachsen-AnhaltLand
DeutschlandBildergalerie + Videos
Orgelgeschichte
Vor 1800 ist nachweislich keine Orgel vorhanden.
Um 1799 „eifrige Bemühung“ des Pfarrers um ein Orgelwerk für die Kirche.
1800 Aufstellung eines gebrauchten Werkes durch Johann Gottfried Kurtze/Halle für 270 Thaler. Die Gemeinde finanzierte aus Spenden 220 Thaler, der Kirchenpatron gab nochmals 50 Thaler dazu – allerdings wollte die Gemeinde laut eines Briefs des Pfarrers die Orgel eigentlich gar nicht.
29. März 1800 Lieferung der Orgel (Stüven, S.139), diese wurde wegen des Widerstandes der Gemeinde nicht über Dölbau, sondern über Bruckdorf geliefert.
10. April 1800 (Gründonnerstag) die Orgel wird erstmals durch den Orgelbauer Kurtze selbst gespielt, es fehlen aber noch die Pedalstimmen.
Nach Ostern 1800: Einbau der „Bäße“, also der Pedalstimmen.
1801 wird berichtet, dass die Gemeinde keinen Calcantenlohn zahlen wollte. Die Orgel wird scheinbar nur gespielt, wenn sich umsonst ein Kalkant findet.
1853 Angebot einer Reparatur durch Orgelbauer Schernitz, dieser gibt auch die Disposition des alten Werkes an und will die Quinte 3′ durch einen Principal 8′ ersetzen, zudem will er die Gambe neu liefern – dies geschah anscheinend auch, denn die Orgel besaß später anstatt des für Kurtze typischen Cornetts eine Gambe 8′.
1855 Neubau einer vorderspieligen Schleifladenorgel II/10 mit integriertem Spielschrank durch August Ferdinand Wäldner/Halle für 480 Reichsthaler.
1917 Abgabe der Prospektpfeifen.
1920er Jahre Ersatz durch Zinkpfeifen.
Nach 1940 Einbau eines elektrischen Winderzeugers.
2022 die Orgel ist spielbar, bedarf aber einer Sanierung, für die Spenden gesammelt werden.
Die Wäldner-Orgel in Naundorf (Kabelsketal) ist eines jener kleinen soliden Instrumente, die das wirtschaftliche Rückgrat der Fa. Wäldner aus Halle bildeten und die heute unverdrossen und zuverlässig nach wie vor ihren Dienst tun. Während die Kirche sehr schlicht und puristisch gestaltet ist, zeigt sich der Prospekt des ansonsten recht unspektakulären Werkes durchaus aufwändig und edel gefertigt. Durch die später hinzugefügte Farbgebung im ansonsten weißen Raum auch als interessanter Akzent. Die Schaufront ist dreiteilig (wie hier in der Region seit etwa 1700 üblich) und wird von rechteckigen, kannelurenlosen Pilastern flankiert, die aber dezent geschnitzte Kapitelle aufweisen. Die beiden harfenförmigen Seitenfelder besitzen als Reminiszenz an den früheren Orgelbau geschnitzte Akanthus-Schleierbretter. Das große Mittelfeld ist seinerseits durch runde Pilaster dreigeteilt. Über den Pilastern befinden sich Rundbögen, darüber ein Dreiecksgiebel. Zwischen dem Giebel und den Bögen ist dezent-schlichtes Akanthusschnitzwerk eingesetzt. Auf dem Giebel in der Mitte ist ein hellblaues Akroterion aufgesetzt. Das Gesims, welches das Gehäuse nach oben abschließt, ist mit einem schlichten Würfelfries und einer abschließenden schlichten Zierleiste geschmückt. Das florale Schnitzwerk und die Kapitelle der Pilaster sind in einem etwas verblichenen Grün-Blau gehalten, der Rest des Gehäuses ist in einem gelblichen Beige gehalten. Die Prospektpfeifen bestehen aus Zink. Der Spieltisch ist frontal in das Gehäuse eingelassen und besitzt seitliche Flügeltüren, die Registerzüge befinden sich in absoluter Symmetrie links und rechts des Notenpulteinsatzes. Ein Symmetriezug („Vacat“) ist vorhanden.
Im Inneren zeigt sich die Orgel nach dem klassisch-bewährten Schema konstruiert: Die Rückwand der Orgel wird durch eine in C- und Cis-Seite geteilte, ebenerdig stehende Pedalwindlade mit den beiden Pedalregistern gebildet. Auf Höhe der Prospektöffnungen liegen direkt hintereinander die Windladen der Manualwerke. Das zweite Manual liegt dabei hinter dem Ersten, ist also eher ein Hinterwerk, wenngleich von Wäldner nicht als ein Solches bezeichnet. Auch die Manualwindladen sind in C- und Cis-Seite geteilt, alle Werke stehen auf mechanischen Schleifladen und werden über Wellenbretter angesteuert. Die Balganlage samt Motor befindet sich im Turmraum hinter der Orgel.
Die Disposition zeigt sich, wie vielerorts in der Region, als einmanualige Orgel, deren Stimmen auf zwei Manuale aufgeteilt sind. So befindet sich die bei Wäldner meist vorhandene offene Flöte 8′ nebst dem leisen 4′ (beides Stimmen, die in Wäldners typische „Hauptwerke“ passen würden) auf dem zweiten Manual und erhöhen so die Variabilität und Farbigkeit des Werkes, da auch Triospiel und obligate Registrierungen möglich werden. Die Disposition selbst zeigt sich bewährt-unspektakulär – das Hauptwerk ist ein starkes Manual, das zweite Manual mit zwei Stimmen ist deutlich zurück genommen. Das Pedal besitzt tragende Stimmen. Das Hauptwerk wird durch einen Bordun 16′ (ab c°) grundiert, der dem Werk in dem recht kleinen Raum eine beträchtliche Fülle und Gravität verleiht. Die Achtfußlage wird durch eine scharf-schneidend helle und kraftvolle Viola di Gamba und ein dunkel stilles, aber nicht schwaches Gedeckt 8′ vertreten – diese beiden Stimmen zusammen bilden quasi einen „zerlegten Principal“, ergänzen sich zusammen zu einer Klangfarbe, die einem Principal 8′ sehr nahe kommt. Durch die Zerlegung in zwei Stimmen wird die Vielfalt des Werkes erhöht, gleichzeitig aber die Klangkraft beibehalten. Das Gedackt 8′ überzeugt dabei mit einem herrlich breiten Grundton, die Viola durch farbig-herbe Obertöne und ein deutliches Streichen, ohne hart zu werden. Die restlichen Stimmen des Hauptwerkes bilden die Principalpyramide der Orgel. Ein strahlend-heller, sehr kraftvoller, transparenter Principal 4′ nebst einer sich gut einfügenden, etwas glitzernden Octave 2′ und einer goldenen mit Silberglanz durchleuchteten Mixtur, geben dem Werk ein feierliches Gepräge und zeigen sich gleichzeitig als Reminiszenz an den barocken Orgelbau mit seiner Strahlkraft. Das zweite Manual beherbergt zwei Begleitstimmen: eine perlend-weiche, dabei aber recht präsente Traversflöte 8′ sowie eine kullernd mischfähige, leuchtende Flauto amabile 4′ von recht still-weichem Klang. Vor allem die Viola da Gamba ist mit der Flauto traverso 8′ ein herrlicher Klang, wenn die Viola als Soloregister gebraucht wird, da sie im Tenorbereich fast den Charakter einer durchschlagenden Zunge annimmt. Beide Flötenregister des Hinterwerkes ergeben eine weich-perlende, dezente, aber nicht verwaschene Begleitung oder einen interessanten Gegenpart zu den beiden Grundstimmen des Hauptwerkes. Das Pedal wiederum besitzt mit dem kraftvoll-dunklen, weichen Subbaß 16′ und dem Principalbass 8′ mit seiner stark zeichnenden, obertönig-streichenden Intonation zwei hervorragend tragende Stimmen – die Pedalkoppel ist aber bei kraftvolleren Registrierungen ein Muss. Der Gesamtklang des Werkes ist kraftvoll, gravitätisch, vollmundig, aber transparent, voller Strahlkraft und Helligkeit. Von edlem Goldglanz durchzogen ist das volle Werk, während vor allem die Grundstimmen mit dem Bordun 16′ eine sehr edle, erdig-dunkle, charaktervolle Mischung bringen, auch zur Begleitung von kleinen Ensembles hält die Orgel ausreichend Möglichkeiten bereit.
Da die Orgel grundsolide gebaut ist, ist sie nach wie vor gut spielbar, bedarf aber einer Überholung. Die Klaviaturen müssen neu ausgetucht und vor allem die Manuale neu einreguliert werden, einige Federn des Pedals sollten ausgetauscht werden. Das Innere ist zwar weitgehend frei von Holzwurm und Anobien, bedarf aber einer dringenden Reinigung. Auch die Intonation sollte an einigen Stellen nachgebessert werden. Dennoch ist die kleine Orgel in Naundorf nach wie vor ein gut spielbares, dem Raum angemessenes und klanglich edles und charaktervolles Werk, dessen umfassende Erhaltung ein großes Glück für die hiesige Orgellandschaft wäre.
Disposition
Disposition Wäldner-Orgel
Manual I – Hauptwerk C – f“‘Bordun 16 Fuß. (ab c°) Viola di Gamba 8 Fuß. (C-H gedeckt, Holz, ab c° offen) Gedackt 8 Fuß Principal 4 Fuß Octave 2 Fuß Mixtur 3 fach
|
Manual II – Oberwerk C – f“‘Flauto traverso 8 Fuß Flauto amabile 4 Fuß |
Pedal C – c‘Subbaß 16 Fuß. Principal,,bass 8 Fuß.* |
*das Zeichen „,,“ dient als Zeilentrenner auf dem Registerschild.
Disposition der Kurtze-Orgel (1800) nach Stüven, S.82f.
Manual C,D – c“‘Gedackt 8′ Flöte 8′ Gambe 8′ (nach 1820, um 1800 wahrsch. Cornett) Principal 4′ Gedackt 4′ Quinte 3′ Octave 2′ Mixtur 2fach |
Pedal C,D – c‘Subbaß 16′ Violonbaß 8′ |
Spielhilfen
Als Registerzüge links unten: Manual,,coppel [II/I], Pedal,,coppel [I/P]
Als Registerzüge rechts unten: Vacat, Calcanten,,glocke
*das Zeichen „,,“ ist auf den Registerschildern ein Zeilentrenner.
Gebäude oder Kirchengeschichte
Um 1220 Errichtung einer steinernen Kirche, die in den Grundformen heute noch vorhanden ist – die Kirche war eng verbunden mit dem Kloster Petersberg, weshalb sie auch ein überaus edel gestaltetes romanisches Portal erhielt.
13. Jahrhundert Guss einer Glocke mit dem Durchmesser 60cm (Nominal: e“) durch einen unbekannten Gießer.
Um 1400 Anfügung eines dreiseitigen Chorabschlusses im Osten.
1504 Fertigung des Sakramentshäuschens.
1534 Guss einer Glocke durch einen unbekannten Gießer.
1765 Umguss der großen Glocke durch Friedrich August Becker/Halle, Durchmesser 1,33M.
18. Jahrhundert Umbau der Innenausstattung – Einbau der Empore, Einbau von zeittypischen Segmentbogenfenstern.
19. Jahrhundert Einbau eines zweiten Portales im Turm – Veränderung der Innenausstattung.
1917 Abgabe einer Glocke mit 92cm Durchmesser zu Rüstungszwecken.
1942 Abgabe der großen Becker-Glocke zu Kriegszwecken.
Nach 1950 Aufhängung einer um 1500 gegossenen Glocke (Durchm.: 49cm, Nominal a“), die an einem überdimensionalen Joch zu hängen kam und nicht läutbar ist.
2015 Gründung des Förderkreises „Romanisches Portal“, der sich für die Restaurierung des einmaligen romanischen Portales engagiert.
2016 Überholung von Joch und Aufhängung der heutigen großen Glocke durch Beck/Kölleda.
2017 Fertigstellung der Sanierung des romanischen Portals auf der Südseite der Kirche.
Naundorf mit seinem Nachbarort Dölbau lag einst an einer Handelsstraße zwischen Leipzig und Halle und brachte es dadurch unter dem Einfluss des Klosters Petersberg zu nicht unerheblichem Wohlstand. Viele Ländereien wurden der Kirche Naundorf übertragen, auch die edle Ausstattung (mit einem für die Region ungewöhnlich reich gestalteten romanischen Portal) zeugt vom Einfluss und der Unterstützung des machtvollen Klosters.
Die Kirche selbst zeigt sich als einschiffiger Saalbau mit Westquerturm und dreiseitigem Chorabschluss. Das heute verputzte Bauwerk wurde aus Feldsteinen in Bruchsteinbauweise errichtet. Der Kirchturm im Westen besitzt ein Satteldach, die sechs Schallfenster der Glockenstube sind als Biforien ausgeführt, die von jeweils von einem Rundbogen umschlossen werden. Die restliche Außenfassade des Turmes ist ungegliedert. Im Westen findet sich ein rundbogiges, von Ziegelsteinen ummauertes Portal zum Turminnenraum, der von einem Tonnengewölbe überspannt wird. In der Wand sind noch zwei rundbogige Öffnungen erkennbar, mit denen sich der Turmraum einst zum Kirchenschiff öffnete. Das Kirchenschiff besitzt neben schmalen und hohen Segmentbogenfenstern an der Nordwand zwei kleine, hochliegende rundbogige Fenster aus der Erbauungszeit der Kirche. Der Polygonalchor besitzt ebenfalls rundbogige kleine Fenster, die aber erst später eingesetzt worden sein dürften. Hervorstechend ist außen das romanische Portal auf der Südseite, durch welches man heute die Kirche betritt. Es ist in seiner kunstvollen Ausführung in der Region singulär. Das zweifach gestufte Portal besitzt an beiden Seiten je zwei Säulen, der Überfangbogen wird von zwei Rundstabarchivolten verziert und umfasst. Die Säulen sind mit gedrehten Kanneluren, Zickzackbändern und Lilien verziert und stehen frei. Die restliche Zier des Portals ist mit dem Gewände verbunden. Die Kapitelle sind kelchförmig und werden durch Laubwerk verziert. Im Tympanon sind, durch eine Mittelleiste geteilt, je 11 Muschelrosetten und zentral je eine Blattrosette angeordnet. Diese prachtvolle Zier ist durch eine liebevolle Sanierung auf Betreiben des engagierten Fördervereins dankenswerterweise erhalten geblieben. Das Innere der Kirche zeigt sich hell und sehr schlicht. Der Chorraum wird vom Kirchenschiff durch einen mächtigen Rundbogen mit profilierten Gesimsen abgetrennt – dies deutet darauf hin, dass sich hier einst eine Rundapsis befand. Die Wände sind weiß gefärbt. Eine schlichte Holzbalkendecke mit verzierten Querträgern überspannt den recht hohen Raum. Im Zentrum des Blickes liegt der blockartige Steinaltar mit Kruzifix. In der Nordwand des Chors ist ein schlichtes gotisches Sakramentshäuschen mit bekrönender Kreuzblume in die Wand eingelassen. Der Kanzelkorb steht ebenerdig auf der Südseite des Chors, die Felder der polygonalen Kanzel sind rechteckig und farbig umrahmt. Nach oben hin schließt ein schlichtes Gesims ab. Die Empore ruht auf gelben Rundsäulen mit schlichten Kapitellen ohne Kanneluren, sie umfasst L-förmig den Raum und besitzt balkengerahmte Flachfelder, die je ein schmales schwarzes und darinnen ein breiteres gelbes Quadrat als Zierde besitzen. Die Balkenrahmungen selbst sind im selben Türkiston wie die Verzierungen des Orgelprospektes gehalten. Unter der Empore im Westen sind zwei vermauerte Rundbögen sichtbar, die den ehemaligen Durchgang vom Turm ins Kirchenschiff markieren. Das Innere ist hell, weit, schlicht und erhaben, puristisch und ganz auf Gottes Gegenwart, Musik und Wort konzentriert und als Solches sehr wirkungsvoll sowie akustisch für Wort und Musik sehr günstig.
Anfahrt
Quellenangaben
Orgelbeitrag erstellt von: Johannes Richter
Dateien Bilder Kirche und Orgel: Johannes Richter
Orgelgeschichte: Johannes Richter mit Informationen aus W. Stüven – Orgel und Orgelbau im Halleschen Land vor 1800, Breitkopf&Härtel, Wiesbaden 1964
Kirchengeschichte: Informationen vom Webauftritt des Fördervereins Romanisches Portal Nauendorf, abgerufen am 03.02.2022
Webauftritt des Förderkreises
Historische Disposition in: W. Stüven – Orgel und Orgelbau im Halleschen Land vor 1800, Breitkopf&Härtel, Wiesbaden 1964, S.82f.


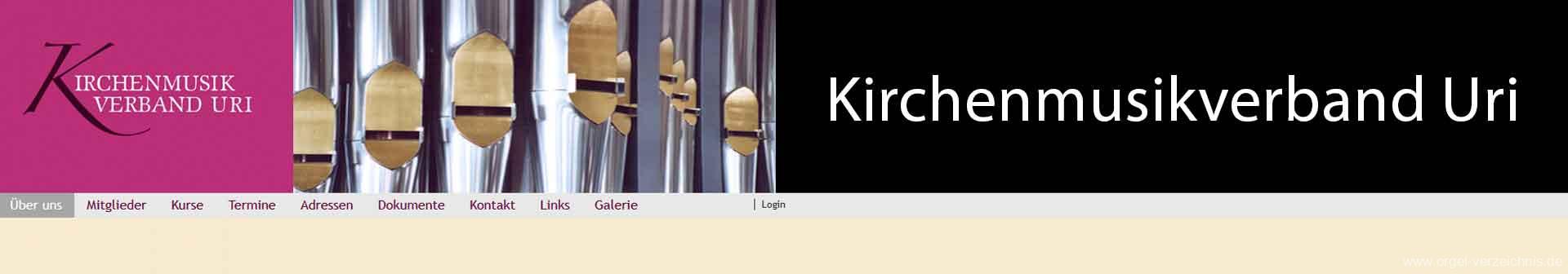

 Deutschland
Deutschland Schweiz
Schweiz Österreich
Österreich Andere
Andere