Orgel: Halle (Saale) / Südl. Innenstadt – St. Johannes
Für Anfragen kontaktieren Sie bitte das Orgel-Verzeichnis über das Kontaktformular.


HELP
Gebäude oder Kirche
St. JohannesKonfession
EvangelischOrt
Halle (Saale) / Südl. InnenstadtPostleitzahl
06110Bundesland / Kanton
Sachsen-AnhaltLand
DeutschlandBildergalerie + Videos
Ungehört – ungespielt – Stiller Klang 3 – Halle (Saale) – ev. Johanneskirche
Halle (Saale)/Südl. Innenstadt (D-ST) – ev. Kirche St.Johannes – Einzel- und Vollgeläut (Turmaufnahme)
Bildrechte: Datenschutz
Orgelgeschichte
1893 Neubau einer pneumatischen Kegelladenorgel II/25 (24+1) als Opus 138 durch Wilhelm Rühlmann (Zörbig) hinter einem neogotischen Gehäuse nach Entwurf von F. Fahro.
1917 Abgabe der originalen Prospektpfeifen.
1923 Ersatz durch Zinkpfeifen durch die Erbauerfirma.
1953 Umdisponierung der Orgel durch R. Adam (Halle), dabei Anbau eines neuen Spieltisches mit neuen Registerschaltern, sowie Erweiterung des Pedalumfanges und Hinzufügung einiger Register v.a. im Pedal. Dadurch besaß die Orgel anschliessend 29 Register, zwei Manuale und Pedal auf pneumatischen Kegelladen. Teile des Rühlmann-Pfeifenwerkes wurden weiter verwendet und umgearbeitet.
Ab 1977 keine weitere Nutzung der Orgel – Ausplünderung, Zerstörung durch Vandalismus und Verlust des größten Teils des Pfeifenwerkes.
Nach 1977 u.a. Brandlegung in der Orgel, erneute Plünderung des Pfeifenwerkes, Einnistung von Tauben im Gehäuse – dadurch Schäden am Pfeifenwerk.
nach 2000 Aufstellung eines Ahlborn-Orgelkeyboards.
Mitte 2012 Einbau einer Hoffrichter-Digitalorgel an die Stelle des alten Spieltisches – Einbau einer Lautsprecheranlage in Kirche und Orgelgehäuse.
In diesem Zustand ist die Orgelsituation in der Johanneskirche noch heute vorzufinden. Die große Rühlmann-Orgel ist nach wie vor unspielbar und schwer beschädigt.
Die 138. Orgel der Zörbiger Werkstatt hinter ihrem neogotischen, sehr schönen Schnitzprospekt war einst eine der großen Rühlmann-Orgeln der Stadt. Der Schaden, den sie nahm, ist umso bedauerlicher, wenn man weiß, dass dies die erste große Orgel war, die Rühlmann in die Saalestadt lieferte, die anderen großen Instrumente der Firma (Stephanus- und Pauluskirche, Bartholomäuskirche, Laurentiuskirche, Lutherkirche, Marktkirche) folgten erst später. Diese Orgel war also quasi Rühlmanns Vorzeigewerk in Halle, seine Eintrittskarte. 25 Register füllten die Kirche einst mit mächtigem und vollen Klange, später wurden es 29, danach verlor die Orgel ihre Stimme für voraussichtlich immer. Das freistehend schmale neogotische Gehäuse gemahnt in seiner Aufteilung an einen scheinbaren Werkaufbau. Ein breites Mittelfeld, über dem zwei kleine Spitzbogenfelder bekrönt von einer Rosette angeordnet sind, wird umrahmt von zwei großen, flachen spitzbogigen Pfeifenfeldern, die einen hohen Spitzgiebel mit bekrönender Filiale besitzen. Über dem Mittelfeld erhebt sich ein hoher Spitzgiebel hinter dem sich den Formen des Prospektes folgend das nach oben spitz zulaufende Schwellwerksgehäuse erhebt, das von vorne als solches nicht sofort erkennbar ist, da es ebenfalls mit bekrönenden Filialen und Kreuzblumen besetzt ist. seine Schwelljalousien sind unsichtbar an den Seiten dieses Giebels angeordnet, den Gesamteindruck des Prospektes nicht störend. Goldene Bänder und neogotische Verzierungen verleihen dem Prospekt eine in die Höhe strebende Wirkung, die durch zwei breite Querriegel etwas abgedämpft wird. Der Spieltisch war stets vorne am Gehäuse angefügt, der ehemalige Spieltisch der pneumatischen Orgel musste der Hoffrichter-Orgel weichen und steht nun rechts an der Seite völlig unbeachtet und schwer beschädigt.
Im Inneren steht auf der Höhe der Prospektöffnungen die Windlade des ersten Manuals, darüber das Schwellwerk mit seinem dachartigen Gehäuse mit den seitlichen Schwelljalousien. Beide Manualladen sind in C- und Cis-Seite geteilt, die Pfeifen des Hauptwerkes sind nach außen hin aufsteigend angeordnet und ragen an der Seite über den Prospekt hinaus.
Die geringe Tiefe des Holzgehäuses täuscht. Das Pedal samt Balganlage steht im dahinter sich öffnenden Turmraum, die Pedallade ist zum Hauptwerk um 90 Grad gedreht nach hinten aufsteigend chromatisch angelegt. Bemerkenswert ist der für die Erbauungszeit untypische Pedalumfang bis f‘. Das Pedal, welches in der Orgel lagert, ist jedoch original von der Erbauerfirma erhalten – die Form der Obertasten weist dies eindeutig aus.
In den 50er Jahren wurde das Instrument von R. Adam aus Halle einschneidend verändert und erweitert, hierfür auch ein neuer Spieltisch angefertigt. Die Orgel verlor dabei ihren grundtönig romantischen Charakter, wurde (immerhin unter Beibehaltung der „romantischen“ Spielhilfen“) zu einer Pseudo-Barock-Orgel umgestaltet. Dabei wurden Teile der Rühlmann-Orgel weiterverwendet, u.a. wurde Rühlmanns Violon 16′ schlicht in Prinzipal 16′ umbenannt und originalgetreu belassen- ähnliches geschah dereinst in der Stadtkirche Bitterfeld. Daran ist gut ersichtlich, wie sich Vorstellungen von Mensuren geändert haben – der für Rühlmann eher schmale Violon 16′ war als Principal in der damaligen Zeit scheinbar ausreichend mensuriert.
Über den Klang der Orgel kann der Verfasser leider keine Worte verlieren, da das Instrument schon lange nurmehr ein Fragment bzw. ein Torso ist. Sie dürfte aber trotz der neobarocken Umbauten den Raum noch ausreichend gefüllt haben, so wie es bei anderen derartig umgestalteten Orgeln von Rühlmann der Fall ist.
Der Zustand des Torsos ist heute sehr schlecht. Große Teile des Pfeifenwerkes (v.a. Metallpfeifen) sind verloren und geplündert. Viele verbliebene Pfeifen sind stark verbeult oder ganz platt gedrückt und liegen teilweise achtlos gestapelt übereinander umher. Auch diverse Pfeifen der Trompete 8′ sind verschwunden – teilweise sind Becher verbogen.
Die Holzpfeifen sind zwar frei vom Holzwurm, jedoch durch Taubenkot stark angegriffen und verschmutzt. Staub und Dreck sowie diverse Schutt-Teile liegen teilweise zentimeterhoch in der Orgel auf den Windladen – Rasterbretter sind ebenfalls stark beschädigt. Die pneumatischen Leitungen des Spieltisches wurden beim Ausbau desselben rigoros abgerissen und hängen unter der Windlade frei. Das Instrument wäre zwar zu retten, aber nur mit einem immensen finanziellen Aufwand. In der Orgel auf der Windlade des Hauptwerkes stehen heute die Lautsprecher für die Hoffrichter-Orgel, die vorne am Prospekt steht und dort wohl auch bleiben wird. So ist dieses Fragment einer Orgel ein Mahnmal für ihren Erbauer und ein Mahnmal für den teilweise misslichen Umgang mit kirchlichem Kunstgut zu DDR-Zeiten. Stumm und still schmückt sie den Raum mit ihrer prachtvollen neogotischen Fassade. Ein Wunschtraum sei dennoch erlaubt – dass die prachtvollen Klänge einst nicht mehr aus Lautsprechern, sondern aus dem Gehäuse, aus sprechenden Pfeifen, mit Lippen und Zungen und atmendem Wind, erklingen werden…
Disposition
Disposition Stand 2021
Manual I – Hauptwerk C – f“‘Quintade 16′ R Prinzipal 8′ R Rohrgedackt 8′ Oktave 4′ R Spitzflöte 4′ Quinte 2 2/3′ R Oktave 2′ R Blockflöte 2′ Terz 1 3/5′ Mixtur 4f.5 (sic) Trompete 8′ |
Manual II – Oberwerk (schwellbar) C – f“‘Gedackt 8′ Quintade 8′ Salicional 8′ Prinzipal 4′ Rohrflöte 4′ Waldflöte 2′ Quinte 1 1/3′ Sifflöte 1′ Terzzymbel 3f. 1 3/5′ Krummhorn 8′ |
Pedal C – f‘Prinzipal 16′ (bei Rühlmann Violon 16′, Holz, offen) Subbaß 16′ R Prinzipal 8′ Gedackt 8′ Choralbaß 4′ Flachflöte 2′ Hintersatz 5f. 2 2/3′ Fagott 16′ |
Disposition Rühlmann 1893
Manual I – Hauptwerk C – f“‘Bordun 16′ Principal 8′ Hohlflöte 8′ Gedackt 8′ Gamba 8′ Octave 4′ Flauto harm. 4′ Quinte&Octave 2 2/3’+2′ Mixtur 4f. Trompete 8′ |
Manual II – Oberwerk (schwellbar) C – f“‘Liebl. Gedackt 16′ Geigenprincipal 8′ Liebl. Gedackt 8′ Flauto trav. 8′ Salicional 8′ Vox céleste 8′ (ab c°) Fugara 4′ Flauto amab. 4′ Flautino 2′ Oboe 8′ |
Pedal C – d‘Violon 16′ Subbaß 16′ Octavbaß 8′ Violoncello 8′ Posaune 16′ |
Spielhilfen
Als Registerschalter halblinks: II-I, I-P, II-P, Tremulant
Als kleine Züge über den Registerschaltern in zwei Reihen: Züge für freie Kombinationen 1+2
Links neben den Registerschaltern: Crescendo [Anzeige für Crescendo in Halbbogenform mit 10 Stufen)
Rechts neben den Registerschaltern: Zungen ab – F – T – K [Kürzel für Fagott, Trompete, Krummhorn]
Als Kollektivdrücker in der Vorsatzleiste unter Manual I, von links: Fr.K.1, Fr.K.2, Auslöser, Org.pl, Tutti
Über dem Pedal mittig: Crescendowalze (Rollschweller), Schwelltritt für Jalousieschweller II
Gebäude oder Kirchengeschichte
1892/93 Neubau einer neogotischen, dreischiffigen Hallenkirche nach Plänen von Friedrich Fahro.
10.11.1893 Einweihung der Kirche in einem Festgottesdienst.
1917 Abgabe zweier Glocken, welche durch Ulrich (Laucha) gegossen worden waren, zu Rüstungszwecken.
1922 Guss zweier neuer Glocken durch Schilling&Lattermann aus Eisen.
Nach 1945 stete Verschlechterung des baulichen Zustandes, da die Johanneskirche zu DDR-Zeiten keine Förderung erhielt und aus dem Förderungsplan der Kirche gestrichen wurde.
24.12.1977 letzter Gottesdienst in der Kirche – Dach und Heizung waren bereits schwer beschädigt.
Nach 1977 Nutzung der Kirche als Lager. Dadurch Schäden am Innenraum – Vandalismus an den wertvollen Fenstern des Altarraumes, welche zu 70 Prozent zerstört wurden, weiterhin Vandalismus an der Orgel, Brandlegung an selbiger, etc.
1991 Beginn der Sanierungsarbeiten mit der Instandsetzung des Kirchturms samt Uhr und Glockenanlage, die Sanierung selbiger besorgte Laszlo Szabo (Atern).
1993 Sanierung des Kirchendaches und Neueindeckung – erste Öffnung der Kirche seit 1977. Feier mit einer Andacht.
1998 Beschluss zur vollständigen Sanierung der Kirche.
2000 Aufnahme erster Gottesdienste in der Kirche.
2002 Abschluss des ersten Sanierungsabschnittes. Große Teile der Außenmauern und der Putz des Inneren wurden wieder hergerichtet.
2004 -2011 weitere Sanierungsarbeiten an Turm, Chorfenster, Innenausstattung, Dach etc., sodass seit 2011 der Baukörper vollständig gesichert ist.
Die Johanneskirche in Halle ist der erste verwirklichte Sakralbau des Architekten Friedrich Fahro und als solcher sehr wirkungsvoll. Das Gotteshaus liegt eingebettet in die kreisförmige Umbauung des Johannesplatzes, dessen Zentrum die Kirche bildet und dessen Gestalt an die Form eines Fisches erinnert. Das Bauwerk als solches ist als dreischiffige Hallenkirche in neogotischem Stil mit polygonalem Ostchor in 5/8-Form und eingezogenem Turm. Die Mauern sind aus roten Ziegelsteinen erbaut – Formklinkersteine, Gesimse und Strebepfeiler gliedern das Äußere. Die Kirchenfenster sind zweiteilig als Biforien mit darüber liegenden Rundbogenfenstern gefertigt.
Der Chor und die Sakristeien sind jeweils polygonal in fünf Achteln eines Oktogons (also im 5/8-Abschluss) ausgeführt. Der schlanke 61m hohe Turm ist auf quadratischem Grundriss erbaut und mündet oben in einen achteckigen Spitzhelm. Links und rechts sind zwei Treppentürmchen mit eigenen Zugängen angefügt. Über dem Turmportal befindet sich ein in einen Spitzgiebel eingelassener Rundbogen, in welchem sich (einem Tympanon gleich) ein Mosaik mit floraler Ornamentik und ein Kreuz mit Christusmonogramm umspielend befindet. Darüber ist im Giebel eingelassen ein weiteres, kreisrundes Mosaik mit einer Darstellung des Patrons der Kirche, über diesem liegt ein Achtpassfenster.
Davor auf dem Giebel ist ein verziertes Kreuz angebracht. Die Schallfenster des Turmes sind als Biforien mit darüber liegenden Achtpaßfenstern ausgeführt. Der Innenraum des dreischiffigen Bauwerkes ist hallenartig und durch das breite Hauptschiff in Verbindung mit den schmalen Seitenschiffen sehr licht und weit, wozu auch die Höhe von immerhin 16 Metern unter dem Gewölbescheitel beiträgt. Das Innere wird von einem rundbogigen Kreuzrippengewölbe, dessen Joche durch Gurtbögen aus roten Ziegeln gegliedert sind, überspannt. Die tragenden Säulen des Gewölbes sind ebenfalls durch Klinkersteine akzentuiert und besitzen auf Gesimsen ruhende, mehrfach abgestufte Pilaster. Der Chorraum besitzt ein tonnenartiges Gewölbe, dessen einzelne Bögen durch Klinkersteine hervorgehoben sind – der Chorbogen ist ebenfalls akzentuiert. Bemerkenswert sind die in Hannover geschaffenen, später liebevoll rekonstruierten zweibahnigen Buntglasfenster im Chor, deren runde Oberfenster mit Buntglasmaßwerk verziert sind. Die beiden äußersten Fenster sind mit geometrischen Formen versehen. Nach innen gehend finden sich dann Darstellungen der vier Evangelisten mit ihren symbolischen Gestalten – das zentrale Fenster zeigt die Ausgießung des heiligen Geistes, darüber Christus mit der Bibel.
Alle Fenster sind durch Rundbögen aus Klinkersteinen umrahmt. Unter diesen Fenstern ist ein gemaltes Zierband sichtbar, auf dem (umrahmt von floraler Ornamentik) die Büsten von biblischen Propheten nebst einem Spruchband und Bibelspruch darunter dargestellt sind. Diese Propheten sind im Uhrzeigersinn: Jesaia, Jeremia, Hesekiel und Daniel – im Zentrum hinter
dem Altar Johannes. Der Altar selbst besitzt einen auf vier reich verzierten Säulen ruhenden Tisch. Unter der Platte leicht zurückgesetzt ist, flankiert von zwei Vierpässen, das Christusmonogramm als Fundament des Altars zu sehen. Der Altar selbst ist aus Holz gefertigt und nimmt die gotische Formensprache des Gotteshauses in niedriger Form wieder auf. Ein großer Mittelgiebel mit Spitzbogen und Spitzgiebel wird von zwei kleineren flankiert, die in Zierfeldern geometrische Muster sowie eine Kornähre und ein Ölblatt zeigen. Filialen und Türmchen mit Kreuzblumen sind überall am Altar angebracht. Im Zentrum befindet sich eine große Rosette mit verblichenem Strahlenkranz, daneben zwei kleine runde Zierfelder mit geometrischem Schmuck. In der Mitte thront das Schriftband: Ich bin das Brod (sic!) des Lebens. Joh:6 V.31. Der Altar wird in der Mitte bekrönt von einem Kruzifix. Die Ausstrahlung dieses schlichten Retabels zeigt eindrücklich das Verständnis einer protestantischen Predigtkirche mit Konzentration auf das Wort Gottes. Die Kanzel auf der Südseite des Chorraumes, welcher auf drei Stufen erhöht angeordnet ist, zeigt auf schlankem Fuß mit reich neogotischer Zier am polygonalen Kanzelkorb neogotische Zierfelder mit goldener geometrischer Zier. Der flache Schalldeckel ist reich mit Filialen verziert. Im Zentrum befindet sich ein himmelstrebender Achteckhelm mit Kreuzblume. Die Empore umfasst hufeisenförmig den Raum und unterstreicht die dreischiffige Wirkung des Gotteshauses. Der Raumeindruck ist durch die hohen Fenster überaus hell, bunt, strahlend, durch die Farben weiß und rot freundlich und warm und durch die dunkle Holzausstattung akzentuiert, welche sich ideal in den Raum einfügt und in der Dreifaltigkeit aus Altar – Kanzel – Orgel eine bemerkenswerte Einheit bildet. Wie wunderbar ist
es, dass dieser aussagekräftig schöne und weite Raum für zukünftige Zeiten gesichert und erhalten ist. Wie viel Dank gebührt den treibenden Kräften dieses Unterfangens! Nun fehlt nur noch eines – adäquate Musik…
Anfahrt
Quellenangaben
Orgelbeitrag erstellt von: Johannes Richter
Dateien Bilder Kirche und Orgel: Johannes Richter
Orgelgeschichte: Johannes Richter
Kirchengeschichte: Beitrag auf dem Webauftritt der Gemeinde
Glockenvideo von Johannes Richter auf dem Youtube-Kanal JRorgel


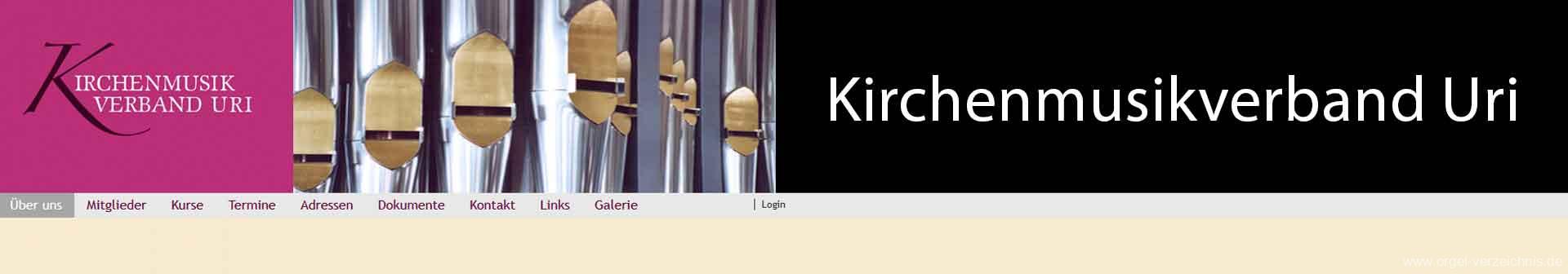

 Deutschland
Deutschland Schweiz
Schweiz Österreich
Österreich Andere
Andere