Orgel: Halle (Saale) / Nördl. Innenstadt-Neumarkt – St. Laurentius
Für Anfragen kontaktieren Sie bitte das Orgel-Verzeichnis über das Kontaktformular.

Gebäude oder Kirche
St. LaurentiusKonfession
EvangelischOrt
Halle (Saale) / Nördl. Innenstadt-NeumarktPostleitzahl
06108Bundesland / Kanton
Sachsen-AnhaltLand
DeutschlandBildergalerie + Videos
JRorgel: Halle (Saale)/Nördl. Innenstadt (D-ST) – ev. Kirche St.Laurentius – Vollgeläut (Außenaufnahme)
Bildrechte: Datenschutz
Orgelgeschichte
16. Jahrhundert Errichtung einer ersten Orgel.
1696 Erwähnung einer Orgel II/P über dem Altar im Osten, die desolat und unbrauchbar war.
1714 Contractabschluss mit Orgelbauer Christian Joachim aus Halle/Saale.
1715 Fertigstellung einer mechanischen Schleifladenorgel II/25 durch Christian Joachim.
1860 Ersatz der Orgel durch eine vorderspielige mechanische Schleifladenorgel II/22 durch August Ferdinand Wäldner/Halle.
1927 Neubau einer vorderspieligen pneumatischen Kegelladenorgel II/27 + 3 durch W. Rühlmann/Zörbig als Opus 415, die Orgel besaß einen Freipfeifenprospekt, das Schwellwerk stand mittig mit sichtbaren Schwelljalousien hinter dem Hauptwerk.
1934 Umdisponierung der Orgel, Erweiterung um ein Register auf II/28 + 3.
1964 war die alte Orgel ungenügend, Ersatz durch eine vorderspielige mechanische Schleifladenorgel II/25 von VEB Schuke Orgelbau (Op.349), die Orgel gehörte der KMS, sollte vorrangig für die Studierenden zum Üben und Unterrichten dienen, wurde aber der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt.
1984 brannte die Schuke-Orgel mitsamt der Kirche nieder.
1994 Neubau einer mechanischen Schleifladenorgel II/24 durch Reinhard Hüfken/Halberstadt, im ersten Bauabschnitt wurden 14 Register (RP und Pedal) erbaut, dabei wurden einige Register der alten Orgel, die noch brauchbar waren, in das Rückpositiv der neuen Orgel integriert, sowie ein Register ins Hauptwerk übernommen (Waldflöte 2′).
1997 Fertigstellung der 10 Register des Hauptwerkes und damit der gesamten Orgel.
2022 die Orgel wird rege im Gottesdienst und zu Unterricht und Prüfungen der EHK genutzt.
Die Orgeln der Laurentiuskirche blicken auf eine lange und wechselvolle, teils auch tragische Geschichte zurück. Namhafte Erbauer ihrer Zeit, unter ihnen nicht nur August Ferdinand Wäldner und Wilhelm Rühlmann, sondern auch Schuke und Hüfken gaben und geben der Kirche ein klingendes Gepräge. Die Vorgängerin der heutigen Orgel wurde ein Raub der Flammen, nur eine verkohlte Windlade ist noch erhalten – die heutige Hüfken-Orgel führt in würdiger Weise die durch das tragische Schicksal unterbrochene Aufgabe der Vorgängerin weiter. Sie steht auf der Südseite der Westempore und ist eine von drei halleschen Orgeln, die über ein Rückpositiv verfügen.
Das Gehäuse darf als überaus gelungener Entwurf betrachtet werden, bildet es mit seiner rotbraunen holzsichtigen Farbe doch einen angenehm warmen Kontrast zu den weißen Wänden und zur hellen Holztonnendecke, zusammen mit den silbernen Prospektpfeifen und ihrem geheimnisvollen Glanz erhält die Orgel damit im Raum eine angenehm dezente, aber gut wahrnehmbare Präsenz.
Hauptgehäuse und Rückpositiv sind einander gegenläufig eingerichtet – während die vier großen, geschwungenen Pfeifenfelder des Hauptgehäuses dem Verlauf der Tonnendecke folgend von unten gesehen nach links abfallen, so vermindert sich die Höhe des Rückpositivgehäuses mit seinen drei großen, dem Hauptwerk reminiszent entgegengestellten Feldern nach rechts. Beide Gehäuseteile besitzen zwei kleine Flachfelder (Hauptgehäuse) bzw. drei kleine Flachfelder (Rückpositiv). Schleierbretter besitzt das Gehäuse, dessen einzelne Rechtecktürme mit den auf- und absteigenden Pfeifenmündungen in sich geschwungen sind, nicht. Dadurch, dass das Haupt- und das Rückpositivgehäuse zueinander kongruent bzw. eines die logische Fortführung des Anderen ist, ergibt sich ein imposant-einheitlicher Eindruck der Orgel, die schwerelos aus der Empore emporzuwachsen scheint.
Der Spieltisch befindet sich am Hauptgehäuse hinter dem Rückpositiv als integrierter Spielschrank mit seitlichen Flügeltüren. Der Spieler hat dabei Rückpositiv und Altar im Rücken. Die Registerzüge befinden sich beiderseits des Notenpultes, links die von HW und Pedal, rechts die des RP, die Koppeln sind gut erreichbar als Fußtritte halbrechts über dem Pedal angebracht, aber leider nicht als Registerzüge angelegt – dies wäre nach Meinung des Autors eine durchaus praktische Einrichtung gewesen. Der Spielschrank nimmt die warme Farbe des Gehäuses auf und führt sie gelungen weiter, die hellen Registerschilder sind ein guter Kontrast zum dunkel-warmen Gehäuse.
Die Orgel steht komplett auf mechanischen Schleifladen, alle Laden sind in C- und Cis-Seite geteilt. Im Hauptgehäuse befindet sich vorne die Lade des HW, hinter dem Stimmgang als Rückwand der Orgel die Lade des Pedalwerkes mit den großen Bässen. Die Balganlage ist im Hauptgehäuse untergebracht. Die Disposition selbst zeigt sich „klassisch“, also vielseitig, aber durch Frühromantik/Spätbarock inspiriert. Das Hauptwerk erhält durch einen füllig-warmen Bordun 16′ Gravität und edle Kraft. Sehr cantabel und transparent, edel und doch mischfähig gibt sich der Principal 8′ mit reichem Obertonspektrum, eine strahlende Octave 4′ und eine silbrige Mixtur 4fach vervollständigen die Principalpyramide des Hauptwerkes. Eine flötig-herbe Quinte 2 2/3′ färbt den Klang, die 2′-Lage ist durch eine leuchtend-weiche Flöte 2′ vertreten. In der Äquallage stehen zwei Charakter- bzw. Solostimmen dem Principal 8′ zur Seite: Eine melancholische Gambe mit verhältnismäßig wenig Strich, eher ins gemshornartige gehend, aber dennoch auch in romantischer Musik als Gamben-Solo gut zu gebrauchen, sowie eine weich perlende, etwas dunkle Hohlflöte 8′ mit leicht spuckender Ansprache. Diese beiden Stimmen füllen die Äquallage sehr gut auf. In der 4′-Lage ist noch eine helle, freudig-kullernde, mit sanftem Strich versehene Spitzflöte vorhanden. Herrlich ist auch der Flötenchor zu 8′,4′,2 2/3′ und 2′ – eine flirrend-warme Mischung, die auf jeden Fall ihren Reiz hat! Dazu tritt im Hauptwerk noch eine eher dunkle, aber kraftvolle Trompete 8′, die sich gut in den Klang einfügt und Gravität und Stärke schenkt. Das Hauptwerk ist also eher gravitätisch und vollmundig, erdig-warm, das Rückpositiv dagegen ist eher hell und spritzig gehalten. Ein warm spuckendes Holzgedackt 8′ (ein hervorragendes Kammermusik-Register!) und eine flirrend-melancholische, vor allem mit dem Tremulanten sehr entrückt tönende Quintadena bilden hier die 8′-Lage. Die Quintadena ist mit der Begleitung durch die Hohlflöte 8′ im Hauptwerk ein äußerst charaktervolles Soloregister! Ein heller, schlanker Principal 4′ mit etwas harter Ansprache, eine spritzig-spitze Oktave 2′, eine etwas herbe, aber weiche Quinte 1 1/3′ sowie eine sehr helle, silbrig glänzende Zimbel bilden hier das klangliche Rückgrat und schaffen Möglichkeiten für ansprechende Soli, die durch die markant schillernde Terz noch bunter und farbiger gemacht werden können. Dazu tritt noch eine weich-runde, zurückhaltende, etwas hohle Rohrflöte 4′ sowie ein schnarrend-knarriges, kantig brummendes Krummhorn 8′, welches mit dem Tremulanten zusammen angenehme lyrische Qualitäten hervorbringt. Durch die exponierte Lage des RP sind die Stimmen jenes Werkes natürlich prädestiniert für obligates Spiel, aber die beiden 8′-Stimmen nebst einer 4′-Stimme können auch eine Soloregistrierung des Hauptwerkes begleiten. Vor allem das Holzgedackt ist ein vorzügliches Begleitregister, vor allem, wenn man die Gambe 8′ als Solo spielen möchte. Das Pedal wiederum ist typisch mitteldeutsch-barock vor allem mit „großen Bässen“ versehen. Hier findet sich bei nur 24 Stimmen tatsächlich ein Principal 16′ (aus Holz), der mit violonartigem Strich und hervorragender Tragfähigkeit mit angenehmen Obertonspektrum aufwarten kann. Ein füllig-warmer, etwas dumpfer Subbass steht ihm zur Seite. Eine Principalstimme der 8′-Lage gibt es nicht, hier steht ein weicher Gedacktbaß 8′ für leise Registrierungen zur Verfügung. Dafür erhält das Pedal einen recht starken, aber nicht aufdringlichen, sanglich-warmen, durchsetzungsfähigen Octavbass 4′ für mittelstarke Pedal-Cantus-Firmus-Registrierungen. Die Aussparung der 8′-Lage im Principalbereich ist also durchaus sinnvoll, da sowieso viel gekoppelt wird. Eine warme, dunkle, nicht zu starke, aber gravitätisch-edle Posaune 16′ bildet den gravitätischen Abschluss des Werkes nach unten, sie ist auch als starke Solostimme gut nutzbar.
Der Gesamtklang der Orgel ist sehr variabel, auch Romantik geht gut auf dem Instrument – dennoch liegen die Stärken sicher eher im Bereich der Universalität. Von gravitätisch-dunkel, erdig und melancholisch bis hin zu spritzig-spitz, hell und freudig sind alle Klangfarben und Solostimmen auf der Orgel möglich. Der Gesamtklang ist raumfüllend und edel, tragfähig und kraftvoll, aber nicht aufdringlich, vor allem das Pedal trägt den Klang sehr gut. Mit der Trompete 8′ wird der Klang dunkel, manchmal auch drohend eingefärbt – eine überaus reizvolle Mischung!
Dass der Zustand der Orgel überaus gut und die Spielbarkeit ebenso ist, muss nach Meinung des Autors nicht extra ausgeführt werden. Es sei nur erwähnt, dass das Rückpositiv auf dem ersten Manual und das Hauptwerk auf dem zweiten Manuale liegt – diese Anlage erfordert anfangs einige Eingewöhnung. Die Hüfken-Orgel in St. Laurentius führt die reiche Geschichte der Kirche würdig weiter und gereicht ihrem Erbauer zur höchsten Ehre!
Disposition
Aktuelle Disposition (2021)
Manual I – Rückpositiv C – g“‘Quintadena 8′ Holzgedackt 8′ S Prinzipal 4′ (Prospekt) Rohrflöte 4′ S Oktave 2′ S Terz 1 3/5′ S Quinte 1 1/3′ S Zimbel 2 fach S Krummhorn 8′ S |
Manual II – Hauptwerk C – g“‘Bordun 16′ Prinzipal 8′ (Prospekt) Hohlflöte 8′ Gambe 8′ Oktave 4′ Spitzflöte 4′ Nasat 2 2/3′ Waldflöte 2′ S Mixtur 4 fach Trompete 8′ |
Pedal C – f‘Prinzipal 16′ Subbaß 16′ Gedacktbaß 8′ Choralbaß 4′ Posaune 16′ |
S=Register aus der Schuke-Orgel 1964 übernommen
Disposition VEB Schuke Potsdam 1946
Manual I – Hauptwerk C – g“‘Quintadena 16′ Prinzipal 8′ Spillpfeife 8′ Oktave 4′ Spitzflöte 4′ Nassat 2 2/3′ Oktave 2′ Mixtur 5-6fach Trompete 8′ |
Manual II – Oberwerk C – g“‘Holzgedackt 8′ Rohrflöte 4′ Prinzipal 2′ Blockflöte 2′ Terz 1 3/5′ Quinte 1 1/3′ Sifflöte 1′ Scharff 4fach Krummhorn 8′ |
Pedal C – f‘Subbass 16′ Gemshorn 8′ Octave 4′ Rohrflötenbass 2′ Mixtur 5fach Posaune 16′ Trompete 8′ |
Disposition Rühlmann 1927
Manual I – Hauptwerk C – g“‘Bourdon 16′ Principal 8′ Hohlflöte 8′ Rohrflöte 8′ Gambe 8′ Oktave 4′ Flauto harm. 4′ Mixtur 3-4fach Cornett 3fach Trompete 8′ |
Manual II – Schwellwerk C – g“‘Liebl. Ged. 16′ Geigenprinzipal 8′ Gemshorn 8′ Flauto trav. 8′ Aeoline 8′ Vox coelestis 8′ Fugara 4′ Flauto amab. 4′ Flautino 2′ Sesquialter 2fach Mixtur 3fach Oboe 8′ |
Pedal C – f‘Violon 16′ Subbass 16′ Zartgedackt 16′ (Tr.II) Principalbass 8′ Cello 8′ Oktave 4′ (Tr.I) Flautino 2′ (Tr.II) Fagott 16′ |
Disposition Rühlmann nach dem Umbau 1934
Manual I – Hauptwerk C – g“‘Bourdon 16′ Principal 8′ Quintadena 8′ Rohrflöte 8′ Oktave 4′ Flauto harm. 4′ Flachflöte 2′ Mixtur 3-4fach Cornett 3fach Trompete 8′ |
Manual II – Schwellwerk C – g“‘Liebl. Ged. 16′ Gemshorn 8′ Flauto trav. 8′ Aeoline 8′ Vox coelestis 8′ Geigenprinzipal 4′ Flauto amab. 4′ Flautino 2′ Sifflöte 1′ Sesquialter 2fach Mixtur 3fach Oboe 8′ Krummhorn 4′ (neu hinzu) |
Pedal C – f‘Violon 16′ Subbass 16′ Zartgedackt 16′ (Tr.II) Principalbass 8′ Oktave 4′ (Tr.I) Flautino 2′ (Tr.II) Fagott 16′ Clairon 4′ |
kursiv – Änderungen 1934
Orgel von August Ferdinand Wäldner 1860
Manual I – Hauptwerk C – f“‘Bordun 16′ Principal 8′ Hohlflöte 8′ Rohrflöte 8′ Viola di Gamba 8′ Octave 4′ Gedackt 4′ Quinte 2 2/3′ Octave 2′ Mixtur 4fach Cornett 3fach |
Manual II – Oberwerk C – f“‘Geigenprincipal 8′ Flauto traverso 8′ Gedackt 8′ Octave 4′ Flöte 4′ Spitzflöte 2′ |
Pedal C – d‘Violon 16′ Subbaß 16′ Principalbass 8′ Gedacktbass 8′ Posaune 16′ |
Disposition der Orgel von Christian Joachim/Halle, 1715 gemäß Dreyhaupt
Manual I – Oberwerck C,D – c“‘Grob Gedact 8′ Quintadehna 8′ Principal 4′ Nachthorn 4′ Quinta 3′ Nassat 3′ Octave 2′ Gemshorn 2′ Superoctav 1′ Tertie 1 3/5′ Mixtur 4 fach Trompete 4′ |
Manual II – Brustpositiv C,D – c“‘Still Gedact 8′ Floet douce 4′ Principal 2′ Suffloet 2′ Spitzflöte 1′ Mixtur 3fach Krumm=horn 4′ Schalmey 2′ Schalmey 4′
|
Pedal C,D – c‘Subbass 16′ Octavbass offen 8′ Octave 4′ Posaunenbass 16′ Cornet 2′ |
Spielhilfen
Hüfken-Orgel (1994/97)
Als Registerzüge rechts unten: Kalkant [Motorschalter], Tremulant [für RP bzw. Man.I]
Als Fußtritte zum Einhaken über dem Pedal halbrechts: I/P, II/P, I/II
VEB Schuke Potsdam-Orgel 1964
Normalkoppeln II/I, I/P, II/P, Tremulant für II
Rühlmann-Orgel (1927-64)
Normalkoppeln II/I, I/P, II/P, Oberoktavkoppel II/I, Unteroktavkoppel II/I, 2 freie Kombinationen, drei feste Kombinationen, Auslöser
Fußtritte: Pianopedal [für II], Walze ab, Koppeln aus Walze, Handregister ab, Rohrwerke ab (Auch als Drücker)
Walze, Balanciertritt für Jalousieschweller, Anzeige für Walze (Crescendo)
August Ferdinand Wäldner-Orgel (1860-1927)
Manual-Coppel, Pedal-Coppel [I/P], Calcanten-zug.
Orgel von Christian Joachim (1715-1860)
Sperrventile für alle drei Werke, Tremulant (auf die ganze Orgel), Zimbelstern, Vogelgesang, Kalkantenklingel, drei Bälge
Gebäude oder Kirchengeschichte
Um 1140 Errichtung der Kirche St. Laurentius in der Vorstadt Neumarkt als Pfarrkirche dieser Siedlung, betreut vom Kloster Neuwerk, das unweit der Kirche lag.
1241 Inkorporierung der Kirche zum Kloster Neuwerk
1467 Guss einer Glocke mit ca. 1100kg Gewicht durch einen unbekannten Gießer.
15. Jahrhundert Entstehung des gotischen Altarschreins.
1478 wurde der Taufstein mit einem Relief des Hl. Laurentius geschaffen.
1. Januar 1547 erste Evangelische Predigt in St. Laurentius
1570 Vergrößerung des Kirchenschiffes nach Osten, Anbau eines dreiseitigen Chorabschlusses, Umgestaltung des Innenraumes.
1570 Setzung und Weihe des neuen Altars, der wie die Kanzel aus der Kapelle des Klosters Mücheln bei Wettin geholt wurde.
1582 Pläne zum Neubau der Kirche, Nickel Hoffmann (Baumeister der Marktkirche zu Halle) fertigt einen Neubauanschlag über 3000 Gulden an. Der Neubau wird wegen Geldmangels nicht ausgeführt.
1602 Guss einer Glocke durch Georg Wolgast/Halle.
1611 Reparatur des Kirchenschiffes
1690 erneute Erweiterung des Kirchenschiffes – dieses wurde auf der Südseite um Seitenkapellen, auf der Nordseite um ein Seitenschiff ergänzt.
1751 Umbau des Inneren im barocken Stil, Erhöhung des nördlichen Seitenschiffes, Einbau einer Empore im selbigen Seitenschiff.
19. Jahrhundert: Sanierungsarbeiten an der Kirche.
Um 1930 Umgestaltung des Innenraumes.
16. November 1984 durch Brandstiftung brannte die Kirche bis auf die Außenmauern nieder, die Glocken stürzten herab, das Inventar einschließlich der Orgel verbrannte.
1984-91 Wiederaufbau der Kirche im schlichten Stil.
1991 erneute Weihe der Kirche.
2001 wurde versucht die Glocke von 1467 schweißen zu lassen, dies misslang aufgrund verschiedener Umstände.
2001/02 Guss von drei neuen Glocken (Nominalfolge: f‘-g‘-a‘) durch die Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer aus Halle.
2022 die Kirche wird u.a. auch zu Universitätsgottesdiensten sowie als coronakonformer Probenraum für die Chöre der Ev. Hochschule für Kirchenmusik genutzt.
Die Pfarrkirche St. Laurentius in Halle ist eine der ältesten Kirchen der Saalestadt und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Einst war sie das Gotteshaus des vor den Toren der Stadt gelegenen Ortes Neumarkt und wurde vom Kloster Neuwerk, welches sich in der Nähe der Kirche befand, betreut. Bis 1547 wurden hier katholische Messen durch die Mönche des Klosters abgehalten, seit 1817 gehört der Ort Neumarkt zur Stadt Halle und ist heute von dieser nicht mehr zu unterscheiden.
Das Gotteshaus liegt malerisch auf dem Kirchhof gelegen, umgeben von Bäumen, Häusern aus der Gründerzeit und dem südlich gelegenen Botanischen Garten. Nach dem Brand 1984 wurde die Kirche liebevoll wieder aufgebaut. Das Bauwerk ist als Saalkirche angelegt. Die Kirche steht auf rechteckigem Grundriss, der Chor ist dreiseitig im Osten angefügt, im Westen befindet sich der romanische Turm auf rechteckigem Grundriss. Das Untergeschoss, welches etwas schmaler als das Kirchenschiff ist, mündet über zwei Giebel in die rechteckige Glockenstube, welche romanische Rundbogenarkaden besitzt und von einem Satteldach bekrönt wird. Im Süden ist deutlich der Anbau der Seitenkapellen zu sehen, im Norden ist an der Nordwestecke der Ansatz des Seitenschiffes erkennbar. Die seitlichen Anbauten des zweischiffigen bzw. nahezu dreischiffigen Bauwerkes münden in den breiten dreiseitigen, fensterlosen Chorabschluss. Das Dach ist tief herabgezogen und verleiht der Kirche damit ein gedrungenes Äußeres, welches durch breite Rundbogenfenster und ovale Rundfenster gegliedert wird, die die verputzten Außenmauern durchbrechen. Fünf Dachgauben mit Fenstern durchstoßen auf Nord- und Südseite das Satteldach. Diverse alte Grabplatten und Epitaphe sind an die Außenmauern angelehnt oder in jene integriert.
Das zweischiffige Innere, welches durch den Südanbau einen dreischiffigen Eindruck erhält, ist weit, hell und freundlich – nach dem Kirchenbrand wurde es in sehr schlichter Form wieder hergestellt. Die Wände sind in weiß bemalt, eine aus hellem Holz gefertigte Tonnendecke überspannt das Mittelschiff. Der südliche Anbau öffnet sich in Rundbögen zum Kirchenschiff, die einzelnen dadurch gebildeten Räume besitzen ein Kreuzgewölbe. Die Empore auf der Nordseite wird durch breite Segmentbögen getragen und öffnet sich im Emporengeschoss wiederum mit breiten Segmentbögen zum Kirchenschiff. Der Altar ist heute ein schlichter steinerner Blockaltar mit einer massiven Sandsteinplatte als Altarmensa. Hinter dem Altar erhebt sich auf der weißen Wand des Chorraums sehr eindrucksvoll ein Balkenkreuz, welches aus verkohlten und dadurch schwarzen Balken des Kirchenbrandes gebildet wird und somit mahnend an dieses Ereignis erinnert. Eine Figurine des Hl. Laurentius ist an der Südwand des Kirchenschiffes zu sehen, das Taufbecken ist kelchförmig und vom Kirchenbrand schwer gezeichnet, heute ist darauf noch ein Relief des Hl. Laurentius zu erkennen. Zwei Segmentbögen unter der Empore öffnen den Turmraum zum Kirchenschiff. Jener Raum wird heute als Gedenkstätte an den Kirchenbrand und den Wiederaufbau genutzt. Die Empore umfasst L-förmig den Raum, im Westen schwingt das trägerlose Bauwerk leicht zurück und besitzt eine Metallbalustrade. Auf der Nordempore ist eine verglaste Winterkirche logengleich eingebaut. Der Raumeindruck ist erhaben und sehr schlicht, Orgel und Altar bzw. Kreuz bilden eine sich eindrucksvoll ergänzende Einheit. Es darf wohl gesagt werden, dass die (akustisch hervorragende!) Laurentiuskirche einer der schlichtesten und wirkungsvollsten Räume der Saalestadt Halle ist, dessen Wiederaufbau ein großes Glück ist, welches mit großem Dank an die Gemeinde verbunden werden muss.
Anfahrt
Quellenangaben
Orgelbeitrag erstellt von: Johannes Richter
Dateien Bilder Kirche und Orgel: Johannes Richter
Orgelgeschichte: Schulz, Christoph: Die Orgeln in der St. Laurentius-Kirche zu Halle (Saale). Halle 1995., sowie: Hans-Joachim Falkenberg: Zwischen Romantik und Orgelbewegung – Die Rühlmanns. Ein Beitrag zur Geschichte mitteldeutscher Orgelbaukunst 1842-1940. Hrsg.: Hans-Joachim Falkenberg. Orgelbau-Fachverlag Rensch, Lauffen 1995, ISBN 3-921848-19-9, S. 11., ergänzt durch eigene Sichtung vor Ort
Kirchengeschichte: Ínformationen aus: Peggy Grötschel, Matthias Behne: Die Kirchen in der Stadt Halle. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2006, ISBN 3-89812-352-9. Seite 54–57. sowie eigene Sichtung durch Johannes Richter vor Ort
Historische Dispositionen in: Die Orgeln in der St. Laurentius-Kirche zu Halle (Saale). Halle 1995 und Zwischen Romantik und Orgelbewegung – Die Rühlmanns. Ein Beitrag zur Geschichte mitteldeutscher Orgelbaukunst 1842-1940. Hrsg.: Hans-Joachim Falkenberg. Orgelbau-Fachverlag Rensch, Lauffen 1995, ISBN 3-921848-19-9
Youtube-Video von Johannes Richter auf dem Kanal JRorgel


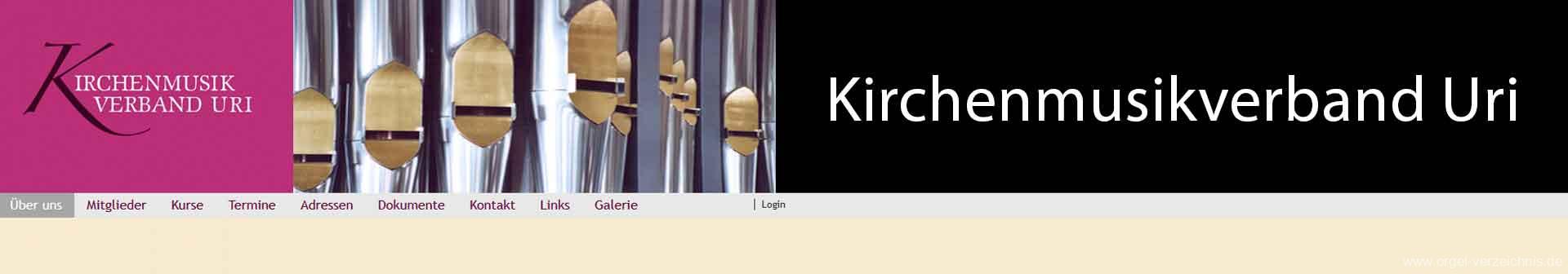

 Deutschland
Deutschland Schweiz
Schweiz Österreich
Österreich Andere
Andere