Orgel: Barby (Elbe) – St. Marien
Für Anfragen kontaktieren Sie bitte das Orgel-Verzeichnis über das Kontaktformular.

Gebäude oder Kirche
St. MarienKonfession
EvangelischOrt
Barby (Elbe)Postleitzahl
39249Bundesland / Kanton
Sachsen-AnhaltLand
DeutschlandBildergalerie + Videos
Johannes Richter spielt Max Drischner – Norwegische Variationen III – Nordmöre-Variationen (1936)
Johannes Richter spielt Moritz Brosig – Phantasie über „Christ ist erstanden“ Op.6
Johannes Richter spielt Theophil Forchhammer – Vorspiel über „Christ ist erstanden“
Bildrechte: Datenschutz
Orgelgeschichte
1698 – 1700 Bau einer Orgel durch Heinrich Herbst der Jüngere (Magdeburg).
Derzeitige Orgel
1915 Neubau der heutigen pneumatischen Kegelladenorgel als Opus 383 durch die Werkstatt Wilhelm Rühlmann (Zörbig) II/33 + 1 Transmisson in den historischen und leicht veränderten Prospekt. Der Spieltisch ist fest angebaut.
Bemerkenswerterweise keine Abgabe der Prospektpfeifen – der Prospekt ist heute nicht klingend.
2006 Restaurierung durch die Orgelbauwerkstatt Albert Baumhoer (Salzkotten).
Bemerkenswert sind sowohl das wirkungsvolle Schwellwerk, welches sich auch für die französische Romantik zu eignen vermag, sowie die äußerst differenzierte Aufstellung der Orgel. Das Hauptwerk steht mittig auf zwei Laden geteilt, auf der vorderen, etwas erhöht stehenden Lade steht u.a. die Trompete 8′, auf der hinteren einige dezentere Stimmen. Darüber steht das Schwellwerk, das Pedal
links und rechts nebenstehend. Interessant ist hierbei, dass Hauptwerk und Schwellwerk jeweils chromatisch, das Pedal jedoch in C- und Cis-Seite geteilt ist.
Disposition
I. Hauptwerk C-g“‘Bordun 16′ Principal 8′ Hohlflöte 8′ Gambe 8′ Dolce 8′ Octave 4′ Flauto harm. 4′ Quinte 2 2/3′ Octave 2′ Mixtur 4fach Cornett 2-3fach ab C! Trompete 8′ (aufschlagend, ab c“ doppelte Länge, ab c“‘ labial, Principalmensur) |
II. Schwellwerk C-g“‘Liebl. Gedackt 16′ Geigenprincipal 8′ Bordun 8′ Portunalflöte 8′ Salicional 8′ Aeoline 8′ Vox celestis 8′ ab c° Principal 4′ Gemshorn 4′ Flauto amab.4′ Piccolo 2′ Harm. aetherea 3fach Oboe 8′ (durchschlagend) |
Pedal C-f‘Principalbass 16′ (Holz) Violon 16′ Subbass 16′ Gedacktbass 16′ Tr. II Quintbass 10 2/3′ Octavbass 8′ Flötenbass 8′ Cello 8′ Octavbass 4′ Posaune 16′ (aufschlagend, Becher und Stiefel Holz)
|
Spielhilfen
Als Registerschalter auf der rechten Seite zwischen denen für SW und Ped. (tats. Reihenfolge):
Manualkoppel [II/I], Pedalkoppel z.M.I, Pedalkoppel z.M.II, Oberoktavkoppel II z. I, Pianopedal f.M.II
Rechte Seite: Kalkant
In der Vorsatzleiste unter Manual I (von links):
Freie Kombination, Auslöser, 4 feste Kombinationen 1-4 [pp, mf, f, ff], Tutti, Handregister an/ab, Rohrwerke an/ab
Über dem Pedal, mittig:
Rollschweller (Walze), Schwelltritt (Balanciertritt) für das 2.Manual
Über dem zweiten Manual:
Schalter für fr. Komb. (über den Registerschaltern), Anzeige für Rollschweller [33 Stufen] mittig über dem 2. Manual
Gebäude oder Kirchengeschichte
Ab etwa 1250 Bau des heutigen Kirchenschiffs im frühgotischen, schlichten Stil durch Baumeister Gunthard.
1505 Grundsteinlegung für einen Westturm.
1564 Taufstein von Hans Bechlein.
1565-1571 Neubau des Westturms in der heutigen Gestalt.
1683 umfassender Umbau der Kirche im Innen- und Aussenbereich, dabei Anbau der Seitenschiffe, der Sakristei, neuer Portale, sowie Umgestaltung des Innenraums – Einbau einer Holzkassettendecke, Altar, etc.
1711 Aufsatz einer Schieferhaube mit Laterne auf den Kirchturm.
1719 Bau des Dachreiters.
1722 Fertigung der Kanzel.
1728 Ferstigstellung des Hochaltars.
1858 Turmuhr von Uhrenmacher Fuchs (Zörbig).
1930er Jahre umfangreiche Sanierungsarbeiten.
Ende 1970er Jahre Einsturzgefahr wegen morscher Deckenbalken, die Kirche wird baupolizeilich gesperrt.
1995 Gründung des Kirchbauvereins, anschliessende Sanierung der Kirche.
2020 letzte Sanierung des Bodens der Kirche.
Die Kirche zeigt sich heute als ein heller, lichtdurchfluteter, teilweise dreischiffiger Saalbau mit rechteckigem Chorabschluss, in welchem der große, von Säulen flankierte Altar mit seiner reliefartigen Darstellung der Kreuzigung steht. Farbige und interessante Kontrapunkte setzen sowohl die Kanzel, als auch die reich gestaltete und bemalte Kassettendecke aus Holz, sowie der reich mit Figuren (Putten, König David, Heiligenfiguren) gestaltete Orgelprospekt.
Bemerkenswert sind auch die zweigeschossigen Choremporen mit ihrer dezent grünen Farbgebung, desgleichen die dezent florale Ausmalung der Fensternischen.
Ebenso sehenswert sind diverse historische Grabplatten, sowie der 1564 gestaltete Taufstein- ein letzter Zeuge der Spätgotik in der Kirche.
Anfahrt
Quellenangaben
Orgelbeitrag erstellt von: Johannes Richter
Dateien Bilder Kirche und Orgel: Johannes Richter
Orgelgeschichte: Johannes Richter
Kirchengeschichte: Wikipedia basierend auf Quellen von Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler – Sachsen-Anhalt I. Deutscher Kunstverlag, München/ Berlin 2002, ISBN 3-422-03069-7, S. 3.
Kirchenkreis Egeln (Hrsg.): Segen auf weitem Land – Die Kirchen des evangelischen Kirchenkreises Egeln. Edition Akanthus, Spröda 2016, S. 46.
Webauftritt der Kirchengemeinde
Orgelvideos von Johannes Richter auf dem Youtube-Kanal „JRorgel“


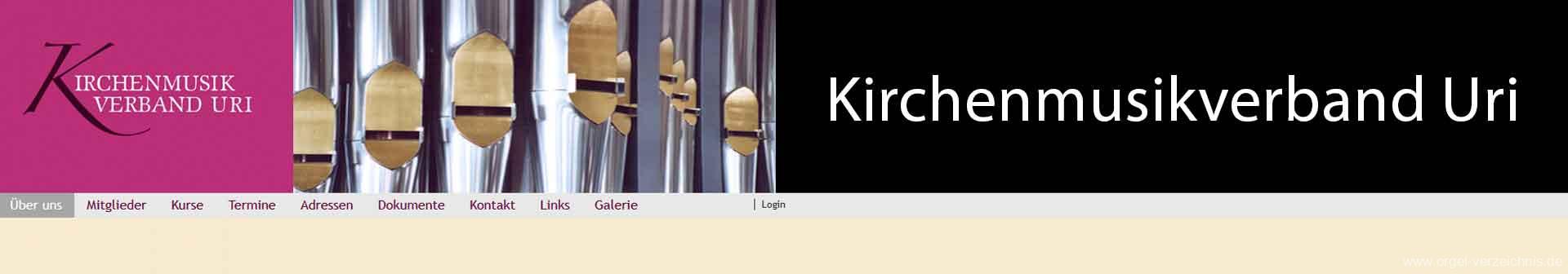

 Deutschland
Deutschland Schweiz
Schweiz Österreich
Österreich Andere
Andere